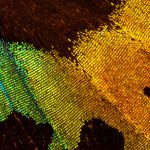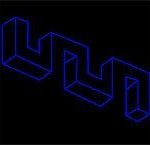Da hatte Eris, die griechische Göttin der Zwietracht, dem armen Hirten Paris ja etwas Schönes eingebrockt. Ausgerechnet er sollte im Wettstreit zwischen den drei Göttinnen Athena, Helena und Venus entscheiden, welcher von ihnen der Apfel mit der Aufschrift „der Schönsten“ gebühre. Das Rennen schließlich machte Venus – ob sie allerdings wirklich die Schönste war, darf bezweifelt werden, immerhin hatte sie Paris bestochen und ihm für seine Entscheidung die schöne Helena versprochen.
Welche Göttin nun auch immer die größte Attraktivität besaß – die Sage zeigt, dass das Streben nach Schönheit schon sehr, sehr alt ist und selbst für diejenigen eine Bedeutung hat, die doch eigentlich schon alles haben. Heute ist es nicht anders, die Kosmetikindustrie macht Milliardenumsätze mit unseren Versuchen, möglichst schön zu wirken. Warum aber wollen wir überhaupt gut aussehen?
Schuld daran ist nur die geschlechtliche Fortpflanzung. Würden wir uns alle parthenogenetisch, also ohne vorhergehende Befruchtung fortpflanzen, wäre uns allen das Aussehen vermutlich furchtbar egal. Die sexuelle Reproduktion aber hat einige Vorteile und konnte sich daher im Laufe der Evolution durchsetzen. Hierbei tragen die Nachkommen nicht die identische genetische Information wie die Mutter, sondern haben Anteile aus den Genen beider Elternteile. Auf diese Weise wird die Variabilität der Gene gefördert und der Genpool einer Population ist eher für veränderte Umweltbedingungen gerüstet – die Wahrscheinlichkeit, dass die Population ausstirbt, ist somit geringer.
Um nun unsere Gene im Genpool zu erhalten, müssen wir möglichst viele Nachkommen mit einer hohen Überlebenschance zeugen – zumindest rein biologisch gesehen. Gesunder Nachwuchs setzt vor allem gutes Genmaterial voraus – und da kommt die Wahl des Partners ins Spiel. Die Kriterien zur Partnerwahl unterscheiden sich kulturell nicht so stark, wie man annehmen könnte.