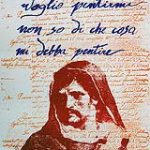Dieser offene Sternenhaufen, direkt über dem Sternbild des Stieres stehend, ist eines der auffallendsten Phänomene am Nachthimmel und taucht in den Überlieferungen und Mythen verschiedenster Kulturen weltweit auf. Die Griechen sahen in ihnen die in den Himmel versetzten Töchter des Atlas, für die Babylonier verkörperten sie die magische Zahl 40, weil sie jedes Jahr im Spätsommer für gut 40 Tage vom Himmel verschwanden.
Die Plejaden als vorzeitlicher Jahreszeitenmarker?
Aber welchen Sinn könnten die Plejaden für die Menschen von Lascaux gehabt haben? Hatte das Siebengestirn für sie möglicherweise auch eine kalendarische Funktion? Von den antiken Griechen, viele Jahrtausende später, ist bekannt, dass sie die Plejaden als Eckpunkte des landwirtschaftlichen Jahres ansahen: Der Dichter Hesiod schrieb im 8. Jahrhundert v. Chr.: „Wenn das Gestirn der Plejaden, der Atlastöchter, heraufsteigt, fanget die Ernte an, die Saat dann, wenn sie hinabgehen.“

Die Plejaden, auch Siebengestirn genannt sind ein offener Sternenhaufen nahe dem Sternbild Stier. Sechs bis sieben von den in Wirklichkeit deutlich zahlreicheren Sternen dieses Haufens sind auch mit bloßem Auge deutlich sichtbar. © NASA/ ESA/ AURO
Aber wie sah das Ganze vor 17.000 Jahren aus? Passte auch damals die Wanderung der Plejaden zu wichtigen Zeiten im Jahreslauf? Rappenglück testete dies, indem er mithilfe einer Computersimulation die Bewegungen der Sterne und Konstellationen vor rund 17.000 Jahren rekonstruierte. Tatsächlich zeigte sich, dass die auffällige Sternengruppe damals jedes Jahr im Herbst auftauchte und im Frühjahr ihren höchsten Stand erreichte. Vom Hügel von Lascaux gesehen, erschienen die Sterne am 11. Oktober kurz vor der Morgendämmerung knapp über dem Horizont, 161 Tage später standen sie in ihrem Zenit und markierten damit den Beginn des Frühlings.
Für den Archäoastronomen Rappenglück ist daher eindeutig, dass die Plejaden auch für die vorzeitlichen Höhlenmaler schon wichtige Anzeiger für die Jahreszeiten waren und dass sie deshalb mitsamt des himmlischen Stieres an der Höhlendecke verewigt wurden.
Drei Höhlenfiguren als Sommerdreieck
In dem riesigen Auerochsen meint Rappenglück zudem noch weitere astronomische Referenzen zu erkennen: So sieht er in der seltsamen durchkreuzten Linie vor dem Kopf des Ochsen eine Markierung für die Position der Milchstraße in den steinzeitlichen Frühlingsnächten. Die dunklen Punkte im Gesicht des Tieres könnten die Sterne der Hyaden, der auch im Zusammenhang mit dem Sonnenobservatorium von Goseck diskutierten Sternengruppe symbolisieren. Das Auge des Auerochsen wäre dann der Aldebaran, der „Augenstern“ des himmlischen Stieres.
Aber auch andere Höhenzeichnungen von Lascaux sieht der umstrittene Forscher inzwischen als Himmelskarten. So finden sich an der Wand des Schachts, einem etwas abseits gelegenen Teil der Höhle, ein Stier, eine Art Vogelmensch sowie ein auf einem Stock sitzender Vogel. Nach Ansicht von Rappenglück repräsentieren die Augen der drei Figuren die Sterne Vega, Deneb und Altair – zusammen als Sommerdreieck bekannt. Sie gehören zu den hellsten Sternen am Sommerhimmel der Nordhalbkugel.
Mit dieser Interpretation steht Rappenglück allerdings zurzeit noch relativ isoliert da. Andere Archäologen und Archäoastronomen zögern, sich dieser hoch spekulativen Sichtweise anzuschließen. Zu wenig ist über die Künstler von Lascaux und ihre Kultur bekannt, zu dünn sind bisher die Indizien.
Zumindest etwas sicherer sind dagegen die Erkenntnisse über die mehr als zehntausend Jahre jüngeren Steinbauwerke, die die Menschen jenseits des Kanals hinterlassen haben.
Stand: 01.02.2008
1. Februar 2008