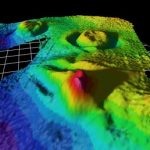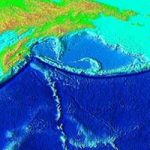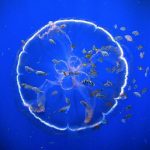„Aale sind Zwitter, haben weder Spermien noch Eierstöcke und entstehen im fauligen Erdschlamm.“ Diese Meinung vertrat der griechische Philosoph und Wissenschaftler Aristoteles, wenn es um die Fortpflanzung der Aale ging. Lebendige Brut, die manch einer seiner Kollegen bei Aalen gefunden haben wollte, hielt Aristoteles für „Eingeweidewürmer“.
Geheimnisvolles Liebesleben
Diese Fortpflanzungstheorie der Aale, die heute ausgesprochen merkwürdig anmutet – Aale sind wie andere Fische auch zweigeschlechtlich und laichen – war dennoch bis weit ins 19. Jahrhundert umstritten. Erst 1922 kam der dänische Zoologe Johannes Schmidt dem Liebesleben der Aale endgültig auf die Spur und entdeckte, dass ihre Fortpflanzung zu den ungewöhnlichsten überhaupt gehört. Weitab von den Flüssen des europäischen Binnenlandes, in der Sargasso-See nördlich der Bermuda-Inseln fand er winzige Aal-Larven.
Bis dahin hatte man die jungen Aale, die die Form von Weidenblättern haben, für eine eigene Spezies gehalten. Doch Schmidt deckte auf, dass jeder Aal in seinem bis zu 20-jährigen Leben zwei große Reisen auf sich nimmt, um sich lediglich ein einziges Mal fortzupflanzen.
Erwachsene Aale, die in Europa lange Zeit für Schlangen gehalten wurden, weil sie sich schlängelnd auch über feuchte Wiesen oder Schotter zwischen Bachläufen bewegen können, leben in Süßwasser. Sobald sie geschlechtsreif sind, begeben sich die Aale flussabwärts auf Wanderschaft, durchqueren Europa bis zu den Flussmündungen, schwimmen hinaus in den Atlantik, um anderthalb bis zwei Jahre später in der Sargasso-See anzukommen.