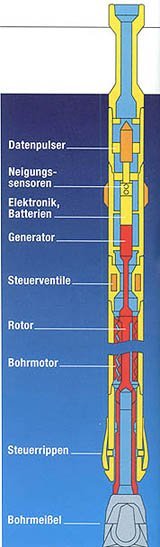Jährlich werden auf der ganzen Welt tausende von Bohrungen niedergebracht, zumeist auf der Suche nach Erdöl und Erdgas. Dabei werden vereinzelt auch ansehnliche Tiefen erreicht, wie zum Beispiel 1974 bei einer Erdgasexploration im US-Staat Oklahoma: der Meißel stoppte dort bei 9583 Metern.
Doch bei diesen Bohrungen werden meist Sedimentgesteine durchbohrt, die weniger hart und wegen der regelmäßigen Schichtenfolge leichter zu durchdringen sind als die sogenannten Metamorphite im Gebiet der KTB.
Die deutschen Geowissenschaftler hatten ursprünglich eine Tiefe von 12 bis 14 Kilometern angepeilt. In diesem Bereich mit Temperaturen von 250 bis 300 Grad Celsius beginnt brüchiges-sprödes Gestein normalerweise plastisch zu werden. Um in eine solche Tiefe zu gelangen, mußten die Geowissenschaftler ein bis dahin ungewöhnlich senkrechtes Loch bohren – und das bei dem sehr harten und in seiner verfalteten Struktur äußerst schwierig zu durchteufenden Gestein des Grundgebirges.
Das Problem ein „gerades“ Loch in die Erde zu bohren, kann man sich etwa so verdeutlichen: Wenn man eine einzelne kurze, dünne Stange in den Boden schiebt, dann ist das Loch, das entsteht, so gerade wie diese Stange. Um tiefer vorzudringen, steckt man jetzt nach und nach neue Stangen auf die alte. Die Gesamtlänge nimmt dadurch zu, man dringt tiefer in den Boden ein, aber diese Art von Teleskopstange wird mit jedem neuen Stück instabiler. Je länger sie wird, desto schlechter wird die Kontrolle über die Stangenspitze im Boden. In gleichmäßig, weichem Boden ist das kein Problem, aber je uneinheitlicher und härter er ist, desto schwieriger wird es, die Stangenspitze „in der Bahn“ zu halten.