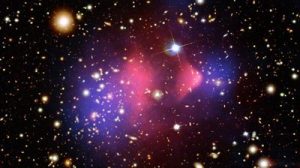Wollte man ein Universum erschaffen, müsste man ziemlich lange tüfteln und ausprobieren, bis man es genau so hinbekommt, dass Galaxien, Sterne, Planeten und letztlich auch wir Menschen darin entstehen und existieren können. „Stellen Sie sich vor, Sie könnten an den Knöpfen der großen kosmischen Maschine herumspielen und hier ein bisschen drehen, um die Elektronen schwerer zu machen oder hier, um die Gravitation ein winziges Bisschen abzuschwächen – was wäre die Folge?“, fragt der britische Physiker und Autor Paul Davies in einem Aufsatz.

Seine Antwort darauf: Das Universum wäre wohl nicht wiederzuerkennen. Es wäre komplett anders, und auch uns Menschen gäbe es wohl nicht. Denn alle Naturkonstanten und physikalischen Gesetze in unserem Universum scheinen geradezu perfekt bis ins Kleinste darauf abgestimmt, dass aus dem Uranfang ein Universum in seiner von uns beobachtbaren Form wurde. Bloßer Zufall? Glück? Oder war es ganz zwangsweise ein Ergebnis der Anfangszustände?
Der Beobachter prägt seine Umwelt
An dieser Frage entzünden sich seit Beginn der wissenschaftlichen Kosmologie heftige Diskussionen. Schon Albert Einstein formulierte provokativ: „Was mich wirklich interessiert ist, ob Gott bei der Erschaffung der Welt überhaupt eine Wahl hatte.“ Oder anders gefragt: Hätte das Universum auch anders entstehen können als in seiner heutigen Form? Ist es uns auf den Leib geschneidert? Oder gibt es vielleicht sogar solche anderen Varianten – als Parallelwelten?
Diese Frage ist einer der Knackpunkte des sogenannten Anthropischen Prinzips: Dieses geht davon aus, dass uns unser Universum tatsächlich in gewisser Weise auf den Leib geschneidert ist – einfach durch die Tatsache, dass wir diejenigen sind, die es beobachten und erforschen. Damit aber nehmen wir Menschen auch nur das wahr, das uns aufgrund unserer Biologie und Fähigkeiten möglich ist.