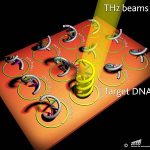Hirschgulasch, Wildschweinbraten, Rehragout – im Herbst hat Wildfleisch Saison. Seit weltweit immer mehr gentechnisch veränderter Mais angebaut wird, ist vielen Verbrauchern der Appetit allerdings etwas vergangen. Schließlich wusste man bislang nicht, wie Wildtiere transgenen Mais verdauen und ob sich Reste etwa im Fleisch ablagern. Münchener Wissenschaftler können diese Sorge jetzt erheblich entkräften – und die Angst vor einer ungewollten Ausbreitung von gentechnisch verändertem Mais per Wildtierkot auch.
Vor einigen Wochen konnte man es noch beobachten: Ganze Wildschwein-Großfamilien wühlen im Frühherbst auf dem Maisfeld und lassen sich die Kolben schmecken. Für heimische Wildtiere ist Mais eine energiereiche Delikatesse, daher kommt er auch gezielt bei der Winter- und Ablenkfütterung zum Einsatz.
Wie gefährlich ist Genmais?
In Zeiten, in denen die Anbaufläche von Genmais auf der ganzen Welt stetig zunimmt, diskutieren Biologen aber eine heiß umstrittene Frage: Was passiert, wenn ein Wildschwein im transgenen Maisfeld nascht oder wenn Damhirsche im Winter mit importiertem Genmais gefüttert werden? Molekularbiologen der Technischen Universität München (TUM) können darauf jetzt die Antwort geben.
Sie haben im Detail untersucht, wie Damhirsche und Wildschweine den Genmais verstoffwechseln und ob über ihren Kot womöglich keimfähiges transgenes Saatgut ungewollt in der Landschaft verteilt wird. Die Wissenschaftler um Professor Heinrich H.D. Meyer vom Lehrstuhl für Physiologie fütterten dazu im Freigehege lebende Damhirsche und aufgestallte Wildschweine jeweils über mehrere Wochen hinweg gezielt mit gentechnisch verändertem Häcksel- und Körnermais.