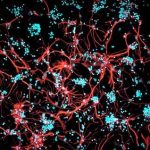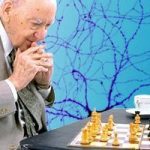Fotografien von natürlichen Szenen eingesetzt
Nathan Cashdollar, Emrah Duzel und Kollegen von der Universität Magdeburg und des University College London zeigen in ihrer neuen Studie, dass diese Vorstellung von Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis nicht der Realität entsprechen könnte. Sie untersuchten Patienten mit einer besonderen Epilepsieform, der so genannten Temporallappenepilepsie mit bilateraler hippocampaler Sklerose, die zu einer ausgeprägten Dysfunktion der Hippocampi führt.
Die Patienten sollten sich dabei Fotografien von natürlichen Szenen, beispielsweise einem Wohnzimmer mit Stühlen und Tischen, einprägen. Ihr Gedächtnis wurde anschließend nach einem kurzen Zeitintervall von nur fünf Sekunden oder einem langem Zeitabstand von 60 Minuten getestet.
Hirnaktivität von Patienten aufgenommen
Wie erwartet, konnten die Patienten nicht zwischen den gelernten und völlig neuen Bildern nach dem langen Zeitintervall unterscheiden, zeigten jedoch normale Leistungen nach dem kurzen. Allerdings trat auch schon nach fünf Sekunden ein merkliches Defizit auf, wenn detaillierte konfigurale und relationale Aspekte der Szene im Gedächtnis gehalten werden mussten, beispielsweise ob der Tisch links oder rechts von den Stühlen stand.
Die Neurowissenschaftler aus Magdeburg und London nahmen zudem die Hirnaktivität von den Patienten auf, während diese die Gedächtnisaufgaben lösten. Dabei entdeckten die Forscher, dass das Kurzzeitgedächtnis für konfigural-relationale Aspekte von Szenen, die aufeinander abgestimmte Aktivierung eines Netzwerkes aus visuellen und temporalen Hirnarealen erforderte, wohingegen das normale Kurzzeitgedächtnis ein gänzlich anderes Netzwerk beanspruchte. Bemerkenswert hierbei war, dass diese koordinierte Aktivierung von visuellen und temporalen Hirnarealen bei Patienten mit hippocampaler Sklerose unterbrochen war.
Zwei getrennte Kurzzeitgedächtnis-Netzwerke
Die neuen Ergebnisse deuten nach Ansicht der Wissenschaftler auf zwei getrennte Kurzzeitgedächtnis-Netzwerke im Gehirn hin: eines, das unabhängig vom Hippocampus fungiert und bei Patienten mit Langzeitgedächtnisstörungen intakt bleibt, und ein weiteres, das vom Hippocampus abhängig ist und mit Störungen des Langzeitgedächtnisses einhergeht.
Aufgrund der vorliegenden Resultate sollte die klassische funktional-anatomische Unterscheidung zwischen Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis, die seit nahezu einem halben Jahrhundert besteht, neu überdacht werden, so die Forscher in PNAS. Die Befunde zeigen, dass Patienten mit beeinträchtigtem Langzeitgedächtnis auch mit Kurzzeitgedächtnisproblemen in ihrem täglichen Leben zu kämpfen haben.
(idw – Universität Magdeburg, 18.11.2009 – DLO)
18. November 2009