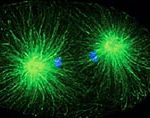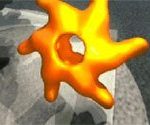Das Vorurteil, Testosteron bewirke beim Menschen aggressives, selbstbezogenes und riskantes Verhalten, ist jetzt durch neue, in „Nature“ veröffentlichte Experimente widerlegt worden. Das internationale Forscherteam hat an über 120 Versuchspersonen sogar belegt: Das Sexualhormon mit dem schlechten Ruf kann faires Verhalten fördern – wenn dies dazu dient, den eigenen Status zu sichern.
{1r}
Populäre Literatur, Kunst und Medien schrieben dem wohl bekanntesten Geschlechtshormon Testosteron seit Jahrzehnten eine Rolle zu, die für Aggressivität steht. Die Forschung schien dies zu bestätigen – führte doch beispielsweise die Kastration männlicher Nagetiere zu einer Reduktion der Streitlust der Tiere untereinander.
Über die Jahrzehnte erwuchs so das Vorurteil, Testosteron verursache aggressives, riskantes und egoistisches Verhalten. Doch von solchen Versuchen bei Tieren zu folgern, Testosteron wirke bei uns Menschen gleich, hat sich nun als Fehlschluss erwiesen, wie eine gemeinsame Studie des Neurowissenschaftlers Christoph Eisenegger und der Ökonomen Ernst Fehr, beide Universität Zürich, und Michael Naef, Royal Holloway, London, zeigt.
Wirkung auf das Sozialverhalten überprüft
„Wir wollten überprüfen, wie das Hormon auf das Sozialverhalten wirkt“, erklärt Eisenegger und fügt hinzu: „Uns interessierte die Frage: Was ist Wahrheit, was ist Mythos?“ Um das herauszufinden, nahmen rund 120 Versuchspersonen an einem Verhandlungsexperiment teil, in dem über die Aufteilung eines realen Geldbetrages verhandelt wurde. Dabei ermöglichten die Regeln, sowohl faire als auch unfaire Angebote zu machen.
Anschließend konnte der Verhandlungspartner das Angebot annehmen oder ablehnen. Je fairer das Angebot, desto unwahrscheinlicher war es, dass der Verhandlungspartner „nein“ sagt. Wenn keine Einigung zustande kam, dann verdienten beide Parteien gar nichts.
Vor dem Spiel erhielten die Versuchspersonen entweder eine Dosis von 0,5 Milligramm (mg) Testosteron oder ein entsprechendes Scheinpräparat verabreicht. „Würde man der gängigen Meinung folgen, wäre zu erwarten, dass die Versuchspersonen mit Testosteron eine aggressive, selbstbezogene und riskante Strategie wählen – ungeachtet der möglichen negativen Auswirkungen auf den Verhandlungsprozess“, erläutert Eisenegger.
Fairer mit Testosteron
Das Ergebnis der Studie lehrte die Forscher jedoch das Gegenteil. Versuchspersonen mit künstlich erhöhtem Testosteronspiegel machten durchgehend die besseren, faireren Angebote als diejenigen, die Scheinpräparate erhielten. Sie reduzierten so das Risiko einer Zurückweisung ihres Angebotes auf ein Minimum.
„Damit ist das Vorurteil, Testosteron trage beim Menschen ausschließlich zu aggressivem oder egoistischen Verhalten bei, hinlänglich widerlegt“, resümiert Eisenegger. Stattdessen legen die Resultate nahe, dass das Hormon die Sensitivität für den Status erhöht. Bei Tierarten mit relativ einfachen sozialen Systemen mag sich ein erhöhtes Statusbewusstsein in Aggressivität ausdrücken.
„In der sozial komplexen Umwelt des Menschen sichert nicht Aggression, sondern pro-soziales Verhalten den Status“, vermutet Naef. „Wahrscheinlich ist es nicht das Testosteron selbst, das Fairness fördert oder aggressiv macht, sondern das Zusammenspiel zwischen dem Hormon und der sozial differenzierten Umwelt.“
Mythos wichtiger als tatsächliche Wirkung
Darüber hinaus zeigt die Studie nach Ansicht der Wissenschaftler, dass die Volksweisheit, das Hormon mache aggressiv, offenbar tief sitzt: Jene Versuchspersonen, die glaubten, das Testosteronpräparat und nicht das Scheinpräparat erhalten zu haben, fielen durch äußerst unfaire Angebote auf. Möglicherweise wurde die Volksweisheit von diesen Personen als Legitimation benutzt, sich unfair zu verhalten.
Der Ökonom Naef meint dazu: „Es scheint, dass nicht Testosteron selbst zu Aggressivität verleitet, sondern vielmehr der Mythos rund um das Hormon. In einer Gesellschaft, in der immer mehr Eigenschaften und Verhaltensweisen auf biologische Ursachen zurückgeführt und teils damit legitimiert werden, muss dies hellhörig machen.“ Die Studie zeigt deutlich den Einfluss von sozialen und biologischen Faktoren auf menschliches Verhalten.
(idw – Universität Zürich, 09.12.2009 – DLO)