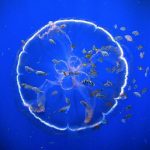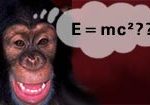Ein Oktopus hat sich als das erste wirbellose Tier entpuppt, das Werkzeuge gebraucht. Wenn die Kopffüßer aus ihrer Wohnhöhle aus Kokosschalen vertrieben werden, sammeln, stapeln und tragen sie die Schalen mit sich. Dabei staksen sie auf ihren steifen acht Armen über den Meeresboden, wie australische Forscher jetzt in „Current Biology“ berichten.
Amphioctopus marginatus ist auf den ersten Blick ein ganz normaler Kopffüßer: mittelgroß, mit rund 15 Zentimeter langen Fangarmen und einem typischen Farbmuster aus verzweigten, venenähnlichen Linien auf dem Körper. Er lebt auf den Sandböden des tropischen Westpazifiks und baut sich gerne Schutzhöhlen aus ins Wasser gefallenen Kokosnussschalen. Doch sein Verhalten hat es in sich: Schon 2005 ertappten Forscher Oktopusse dieser Art dabei, wie sie zwei ihrer Arme wie Beine benutzten und damit über den Meeresboden liefen.
Schalentransporter auf acht Beinen
Jetzt haben Biologen des Museum Victoria im australischen Melbourne die Tiere erneut bei einem ungewöhnlichen Verhalten beobachtet – und dies per Zufall. Einer der Forscher, Julian Finn, berichtet: „Ich konnte sehen, dass der Oktopus etwas vor hatte. Er hantierte mit den Schalen herum.“ Das war nicht außergewöhnlich, da sich die Tiere aus diesen Schalen gerne Schutzhöhlen bauen und sie dann mit ihren Armen herumzerren. „Aber nie hätte ich erwartet, dass er die Schalen aufheben würde und mit ihnen weglaufen. Es war ein extrem komischer Anblick – noch nie habe ich unter Wasser so gelacht.“
Wenn der Oktopus aus seiner Wohnhöhle verscheucht wurde, schwamm er nicht etwa einfach fort. Stattdessen stapelte er zunächst mehrere der halben Kokosschalen seiner Höhle übereinander. Dann machte er alle acht Arme steif und hob sich selbst und die Kokosschalen damit in die Höhe, so dass er wie auf acht Stelzen stand. In dieser Haltung lief der Oktopus dann mitsamt seiner Schalenbeute über den Meeresboden davon. Die Forscher entdeckten im Laufe ihrer Tauchgänge noch weitere Beispiele für dieses Verhalten auch bei anderen Individuen der gleichen Art. Zeitweise liefen die Tiere sogar bis zu 20 Meter weit mit ihrer Schalenfracht, um sich dann am neuen Ort daraus wieder eine neue Höhle zu bauen.