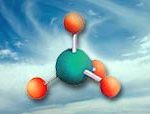Vor 40.000 Jahren führte eine Klimaerwärmung zu einem Anstieg des Treibhausgases Methan. Verantwortlich dafür waren vor allem Feuchtgebiete in hohen nördlichen Breiten. Dies hat jetzt ein internationales Forscherteam herausgefunden. Es widerlegte den in Expertenkreisen auch als „Klathratkanonen-Hypothese“ bezeichneten Erklärungsansatz, dass Methan-Ausstöße am Meeresboden für eine höhere Methankonzentration und die Klimaerwärmung verantwortlich waren.
Frühere Messungen an Eiskernen zeigten, dass die atmosphärische Methankonzentration während plötzlicher Klimaschwankungen in der letzten Eiszeit stark variierte. Klimaschwankungen – so genannte Dansgaard-Oeschger-Ereignisse – kennzeichnen sich durch einen markanten Anstieg von Temperatur und Methankonzentration. Bislang war jedoch unklar, in wie weit vor 40.000 Jahren ein wärmeres Klima zu einer höheren Methankonzentration geführt hatte oder umgekehrt.
Methanemissionen aus Feuchtgebieten
Klimaforscher der Universitäten Bern und Kopenhagen und des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven kommen nun in ihrer Studie zu dem Schluss, dass der beobachtete Anstieg der Methankonzentration zu jener Zeit vor allem auf erhöhte Methanemissionen aus Feuchtgebieten zurückzuführen ist. Diese natürlichen Methanquellen hätten aufgrund einer Erwärmung der nördlichen Breiten mehr Methan produziert und somit zu einer höheren Methankonzentration beigetragen, schreiben die Wissenschaftler in „Science“.
Mit ihrer Untersuchung widerlegen die Klimaforscher gleichzeitig eine kontroverse Hypothese. Sie besagt, dass große Vorkommen von Methan im Meeresboden entlang der Kontinentalränder abrupt freigesetzt wurden und so schnelle Klimaerwärmungen eingeleitet hätten.