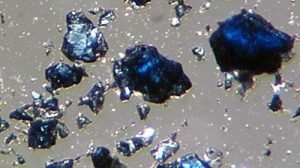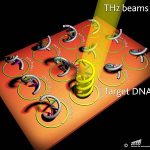Wo entstand das Leben – diese Frage ist bis heute unbeantwortet. Klar ist nur: frei in der Ursuppe schwimmend kann es nicht gewesen sein. Jetzt hat eine amerikanische Forscherin eine neue Hypothese vorgestellt, nach der sich die ersten Zellen im Schutz winziger Zwischenräume in den Schichten des Glimmer gebildet haben könnten. Das blättrige Silikat-Mineral bot ihrer Ansicht nach den ersten Biomolekülen optimale Bedingungen für die entscheidenden Reaktionen.
Eines der großen Probleme in der Erforschung der Lebensentstehung ist die Frage, wo sich die ersten Zellen bildeten. Denn in der freien „Ursuppe“ fehlte die Möglichkeit, die benötigten Moleküle in ausreichender Konzentration und ungestört von parallel ablaufenden Zerfallsprozessen zusammenzuführen. Die meisten Wissenschaftler gehen daher davon aus, dass sich die entscheidenden Schritte in einem geschützten, räumlich eingegrenzten Raum abgespielt haben müssen. Ob dies aber Poren im Gestein, Bläschen oder eine Art hydrothermaler Schlot war, kann bisher nur spekuliert werden.
„Grüner Schleim“ im Glimmer
Helen Hansma von der Universität von Kalifornien in Santa Barbara hat nun eine ganz neue Hypothese zum Ort der Lebensentstehung vorgestellt. Die Idee dafür kam ihr vor einigen Jahren im Urlaub, nachdem sie und ihre Familie in einer alten Mine in Connecticut Glimmer gesammelt hatten. Das Mineral aus schichtförmig angeordneten Silikatverbindungen ist sehr weich und wegen seines Glanzes und seiner blättrigen Struktur bekannt. Zuhause tropfte die Forscherin ein paar Tropfen Wasser auf eine Glimmerprobe und besah sie sich unter dem Mikroskop. Dabei bemerkte sie ein paar grünliche, organische Ablagerungen an einigen Kanten des Glimmers.
„Ich kam darauf, dass das eigentlich auch ein guter Ort für die Entstehung des Lebens gewesen sein könnte – geschützt in diesen Stapeln von Schichten, die sich in Reaktion auf fließendes Wasser auf oder ab bewegten“, erklärt Hansma. „Das wiederum könnte die mechanische Energie geliefert haben, um chemische Bindungen zu erzeugen oder zu brechen.“ Angeregt durch diese Beobachtungen arbeitete die Forscherin ihre Hypothese aus und führte unter anderem Untersuchungen von „Mica“, wie die Schichtsilikate im englischen Sprachraum bezeichnet werden, mit Hilfe des Rasterkraftmikroskops durch.