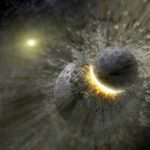Der vor einigen Jahren mit viel Medienrummel proklamierte bronzezeitliche Einschlag eines Meteoriten im Chiemgau hat höchstwahrscheinlich nie stattgefunden. Nachdem im Sommer 2010 die Befürworter der Impakt-Theorie einen Artikel in der Fachzeitschrift „Antiquity“ lanciert hatten, protestierten Geologen und Impaktforscher heftig und veröffentlichen nun die Gegenargumente.
Gab es zur Zeit der Kelten einen Meteoriteneinschlag im Chiemgau oder nicht? Seit zwei Jahren wird in Presse, Rundfunk und Fernsehen sowie in einigen populärwissenschaftlichen Medien über „Krater“ im Chiemgau berichtet, die angeblich durch einen Kometen- oder Meteoriteneinschlag entstanden sind. Diese Ansicht wird von einer Gruppe vertreten, die sich CIRT (Chiemgau Impact Research Team) nennt. Demnach zerbrach ein Komet oder Meteorit beim Eintritt in die Atmosphäre in einzelne Fragmente, die beim Aufprall Krater von einigen bis zu hunderten von Metern Durchmesser in einem Umkreis von 30-60 Kilometern erzeugt haben sollen.
Römerstahl und Phaeton-Mythos
Darüber hinaus wurde die Theorie aufgestellt, dass möglicherweise ein Zusammenhang bestünde zwischen dem Einschlagereignis und der Entwicklung von gehärtetem Stahl zur Waffenherstellung durch die damals dort ansässigen Kelten. Der neue Stahl soll den Römern einen militärischen Vorteil gebracht haben, auf der sich die anschließende Ausdehnung ihres Reiches begründen soll. Außerdem solle auch der griechische Mythos des Phaeton direkt durch den Impakt im Chiemgau angeregt worden sein.
Für Uwe Reimold, Professor für Mineralogie am Museum für Naturkunde in Berlin, der für eine Gruppe von über 20 international angesehenen Meteoriten-Krater-Krater spricht, fehlt diesen Theorien die entscheidende Voraussetzung: „Die Grundlage dieser Argumentationskette, der Einschlag eines extraterrestrischen Körpers auf der Erde, konnte bislang in keiner Weise durch wissenschaftliche Beweise belegt werden.“ Auch von gelogischer Seite gibt es keine Beweise, die ein Einschlags-Katastrophenszenario belegen. Gleicher Ansicht sind auch Martin Rundkvist von der Universität von Chester in England und Robert Huber vom MARUM – Zentrum für marine Umweltforschung.