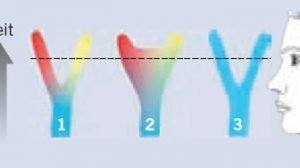Wirtschaftswachstum und Globalisierung haben auch die Tier- und Pflanzenwelt auf der Erde in Bewegung gebracht. Die oft unbeabsichtigte Einwanderung von gebietsfremden Arten zeigt jedoch ökologische und ökonomische Langzeitwirkungen, die weitreichender sind als bisher angenommen. Zu diesem Schluss ist jetzt ein internationales Forscherteam im Fachblatt „Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS) gekommen.
Die Ökologen um Franz Essl und Stefan Dullinger von der Universität Wien und vom österreichischen Umweltbundesamt sehen einen Zusammenhang zwischen der Verbreitung eingeschleppter Spezies und der sozioökonomischen Entwicklung in Europa. Die heutige Verbreitung gebietsfremder Arten ist danach immer noch stark durch die sozioökonomischen Bedingungen von 1900 beeinflusst.
Einwanderungen Kollateraleffekte der ökonomischen Entwicklung
Biologische Einwanderungen sind daher offenbar Kollateraleffekte der ökonomischen Entwicklung, deren Ausmaß erst mit jahrzehntelanger Verspätung in vollem Umfang erkennbar wird. „Eine effiziente EU-Strategie zur Bekämpfung biologischer Invasionen muss daher nicht nur jene Arten umfassen, die in Europa bereits zum Problem geworden sind, sondern auch diejenigen, die sich auf anderen Kontinenten invasionsartig ausbreiten, sich in Europa aber noch unauffällig verhalten oder fehlen“, so Essl.
Hoher ökonomischer Entwicklungsgrad bedeutet hohes biologisches Invasionsrisiko
Bereits vor einem halben Jahr hatten die Forscher im selben Fachblatt gezeigt, dass Bevölkerungswachstum und steigender Wohlstand die wichtigsten Ursachen für die Ausbreitung gebietsfremder Tier- und Pflanzenarten in Europa sind. Der ökonomische Entwicklungsgrad eines Landes beeinflusst nicht nur Intensität und Frequenz der Einschleppung von invasiven Arten, sondern auch Chancen und Tempo ihrer Einbürgerung und Ausbreitung.