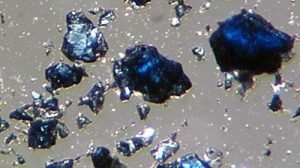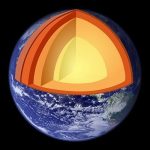Forscher haben jetzt die erste globale geochemische Karte der Landoberfläche erstellt und erstmals diese relativ dünne Schicht mit der gesamten oberen Kruste verglichen. Die jetzt im „International Journal of Earth Sciences“ vorgestellte Karte enthüllt, dass sich die oberste Erdkruste der Kontinente in der Chemie ihrer Gesteine deutlich von tieferen Erdkrustenteilen unterscheidet. Die neuen Daten sind unter anderem auch wichtig für Modelle, die erdgeschichtliche Klimaänderungen erforschen.
Die Oberflächenschicht der Erdkruste ist die „Haut“ der Erde, die Schnittstelle zwischen Geosphäre, Biosphäre und Atmosphäre. Zwar macht sie nur 0,6 Prozent der gesamten Erdmasse aus, doch in ihr laufen wichtige geologische und klimarelevante Prozesse wie zum Beispiel die Verwitterung ab. Da sie für uns Menschen schon immer die zugänglichste Schicht der Erde darstellte, ist sie relativ gut untersucht. Dennoch fehlte bisher ein globaler Überblick der chemischen Zusammensetzung dieser obersten Kruste auf den Landflächen und ein Vergleich mit der Komposition der darunterliegenden Krustenbereiche.
Erste globale Karte aus vereinheitlichten Messwerten
Ein internationales Forscherteam unter Leitung von Jens Hartmann vom KlimaCampus der Universität Hamburg hat nun die erste globale geochemische Karte der Landoberfläche vorgelegt, die die elementare Zusammensetzung der gesamten Landoberfläche zeigt. Für die Karte werteten die Forscher eine Vielzahl wissenschaftlicher Quellen aus und vereinheitlichten deren unterschiedliche Messwerte und Klassifikationssysteme in mehreren Schritten. Die Ergebnisse stehen ab sofort auch anderen Forschern als Open-Access zur Verfügung.
Mehr Verwitterung, dreimal mehr Calcium
Die Ergebnisse zeigen, dass die Zusammensetzung der Oberflächengesteine deutlich anders ist als die durchschnittliche Zusammensetzung der oberen Kruste bis in etwa 15 Kilometer Tiefe. So treten leicht verwitternde Gesteine an der Erdoberfläche häufiger zutage als in tieferen Schichten, auch Ablagerungen und chemische Umwandlungsprozesse in den Sedimenten tragen zu diesen Unterschieden bei. Dies ist besonders deutlich für das Element Calcium, das in Form von Kalksteinen etwa dreimal häufiger an der Oberfläche als in den oberen 15 Kilometern insgesamt vorkommt.
Wichtig auch für Klimaforscher
„Bei der Verwitterung von Kalksteinen wird temporär genau so viel Kohlendioxid aus der Luft gebunden wie bei der Lösung von Kalkstein mobilisiert wird. So kann es zu erheblichen Änderungen der Konzentration des Treibhausgases CO2 in der Atmosphäre kommen – allerdings in geologischen Zeiträumen, also auf einer Zeitskala von Millionen von Jahren“, erklärt Hartmann. Die Ergebnisse sind deshalb für langfristige Klimamodelle wichtig.
Doppelt so viel Chlor und Schwefel
Neben dem hohen Anteil an Calcium finden sich an der Oberfläche auch mehr als doppelt so viel Chlor und Schwefel wie im Durchschnitt der oberen Erdkruste. Diese Elemente stecken in Steinsalz und Gips, so genannte Evaporite. Ähnlich wie die Kalksteine lagerten sie sich vor allem in flachen Meeresarmen auf überfluteten Kontinentbereichen ab und wurden anschließend durch die Gebirgsbildung hochgehoben und der Verwitterung ausgesetzt, ohne in tiefere Erdkrustenbereiche versenkt zu werden. (Int. J. Earth Sci., 2011; DOI: 10.1007/s00531-010-0635-x)
(Universität Hamburg, 10.02.2011 – NPO)