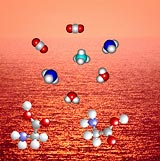Das Leben auf der frühen Erde könnte in einem ziemlich heißen und sauren Milieu entstanden sein. Die Rekonstruktion von vorzeitlichen Enzymen mittels gentechnischer Methoden zeigt, dass diese unter Bedingungen effektiv und stabil arbeiten, die ihre heutigen Nachfahren nicht mehr tolerieren würden. Die jetzt in „Nature Structural & Molecular Biology” veröffentlichte Studie belegt zudem, dass solche molekularen Rekonstruktionen wertvolle Hinweise auf vergangene Lebenswelten liefern können.
Welche Bedingungen herrschten in den ersten Milliarden Jahren nach der Entstehung unseres Planeten? Diese Frage ist bisher nur in Teilen geklärt. Da es damals noch kein Leben gab, fehlen Fossilfunde, Gesteins- und Isotopenanalysen ergeben nur ein unvollständiges Bild. Jetzt aber hat ein amerikanisch-spanisches Forscherteam neue Einblicke mit Hilfe „molekularer Fossilien“ gewonnen. Sie analysierten und rekonstruierten dafür bestimmte Enzyme, die bis heute in allen großen Gruppen des Lebens vertreten sind und deren Ursprung vermutlich bis zu vier Milliarden Jahre zurückreicht.
Ausgangspunkt Enzym-Stammbaum
Für ihre Studie wählten die Forscher sieben so genannte Thioredoxin-Enzyme aus, diese sind unter anderem wichtige Gegenspieler von Oxidationsprozessen in der Zelle. Für diese Enzyme konstruierten sie eine Art „Familienstammbaum“ und verglichen deren kodierenden Gensequenzen bei Archäen, Bakterien und in den Zellen mehrzelliger Tiere. Mit Hilfe von Computerberechnungen rekonstruierten sie dann daraus den „gemeinsamen Vorfahren“, die Enzymsequenzen, die höchstwahrscheinlich vor mehreren Milliarden Jahren vorkamen und bauten diese Sequenzen in Escherischia coli Bakterien ein.
Urzeit-Enzym in heutigem Bakterium wiedererweckt
Tatsächlich produzierten die Bakterien daraufhin die urzeitlichen Enzymvarianten, so dass diese nun in Bezug auf ihre Temperatur- und pH-Toleranz, ihre Effektivität und chemische Funktionsweise direkt untersucht werden konnten. „Indem wir diese Proteine wiederauferwecken, können wir wertvolle Informationen über die Anpassungen von ausgestorbenen Lebensformen an klimatische, ökologische und physiologische Veränderungen gewinnen, die nicht durch die Auswertung von Fossilien enthüllt werden kann“, erklärt Eric Gaucher vom Georgia Institute of Technology.