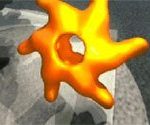Die Eroberung Nord- und Südamerikas durch die Europäer kostete rund die Hälfte aller amerikanischen Ureinwohner das Leben. Das haben Forscher durch den Vergleich moderner und prähistorischer Genproben herausgefunden. Ihre Ergebnisse deuten auf einen drastischen Kollaps in den Bevölkerungszahlen der Ureinwohner vor rund 500 Jahren hin. Dies bestätige erstmals die historischen Überlieferungen, nach denen mit den Europäern Krankheiten, Krieg, Hunger und Versklavung Einzug in die Neue Welt hielten und so die dortigen Ureinwohner stark dezimierten, berichten die Wissenschaftler im Fachmagazin „Proceedings of the National Academy of Sciences“.
„Die Verluste waren dabei nicht auf bestimmte Regionen beschränkt, sondern über beide amerikanische Kontinente verteilt, mit den schwersten Auswirkungen in den am dichtesten besiedelten Gebieten“, erläutert der Anthropologe Lars Fehren-Schmitz von der Universität Göttingen. Er führte die Studie gemeinsam mit seinem Kollegen Brendan O’Fallon von der University of Washington durch.
Einbruch nur kurzfristig
Der dramatische Einbruch war allerdings nicht von langer Dauer, wie die genetischen Daten zeigen. Die indigene Bevölkerung begann im Laufe der folgenden Jahrhunderte wieder zu wachsen. „Dies deutet darauf hin, dass als Ursache nur schnell und kurzfristig wirkende Faktoren in Frage kommen“, sagt Fehren-Schmitz. Wahrscheinlich seien die meisten Ureinwohner an eingeschleppten Krankheiten, durch Hunger und direkte Ausrottung gestorben. Als diese akuten Bedrohungen vorüber waren oder sich die Menschen an die neue Situation anpassten, wurden sie wieder mehr.
Die neuen Ergebnisse widerlegen auch Theorien, nach denen der Niedergang der Ureinwohner bereits vor Ankunft der Europäer begann. Eine Klimaveränderung oder andere Jahrhunderte dauernde Prozesse ließen sich nicht mit den genetischen Daten in Einklang bringen, sagen die Forscher. Es habe sich klar um einen kurzzeitigen, heftigen Einschnitt gehandelt.