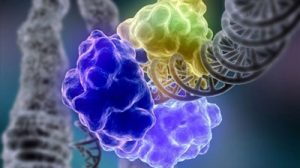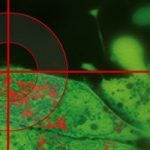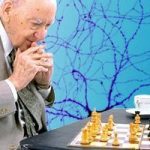Was die Betroffenen bei Alzheimer krank macht, könnte Menschen mit Multipler Sklerose (MS) vielleicht einmal helfen. Diese gewagte These stellen US-amerikanische Wissenschaftler nach Versuchen mit Mäusen auf, die unter einer MS-ähnlichen Krankheit litten. Denn als sie diesen Tieren das Eiweißfragment Abeta injizierten, den Hauptbestandteil der typischen Proteinklumpen im Gehirn von Alzheimer-Patienten, verschlimmerte sich deren Zustand nicht etwa, sondern verbesserte sich überraschenderweise. Diesen Effekt könnte man für eine neue MS-Therapie möglicherweise kopieren. Ein Einsatz des Proteins Abeta als Medikament ist dagegen eher unwahrscheinlich – das Risiko, dadurch doch Alzheimer auszulösen, wäre vermutlich zu hoch. Über ihre Arbeit berichten Jacqueline Grant von der Stanford University und ihre Kollegen im Fachmagazin „Science Translational Medicine“.
{1l}
Abeta, auch beta-Amyloid genannt, gilt als Hauptverursacher von Alzheimer. Bei dieser Krankheit lagern sich mehrere der kurzen Eiweißfragmente zusammen und bilden dichte Proteinklumpen, sogenannte Plaques, die nach der gängigen Theorie zum Tod der Nervenzellen im Gehirn führen. Allerdings kommt Abeta auch in den Gehirnen von Menschen vor, die nicht unter Alzheimer leiden. Es scheint beispielsweise im normalen Alterungsprozess ebenso zu entstehen wie bei Verletzungen des Gehirns oder bei Entzündungen. Geringe Mengen zirkulieren zudem im Blut. Auch bei Multipler Sklerose findet sich Abeta im Zentralen Nervensystem – und zwar vor allem an den Stellen, an denen das Immunsystem fälschlicherweise die fettartige Schicht um die langen Fortsätze der Nervenzellen angreift und dort eine Entzündung hervorruft. Welche Funktion das kleine Eiweißmolekül jedoch hat und welche Rolle es bei MS spielt, ist unklar.
Überraschende entzündungshemmende Funktion
Grant und ihr Team wollten daher wissen, was passiert, wenn man den Abeta-Spiegel im Blut absichtlich erhöht. Dazu injizierten sie Mäusen mit einer künstlich hervorgerufenen Hirnentzündung, die der bei MS gleicht, das Eiweißfragment in den Bauchraum. Doch ihr Verdacht, die Behandlung würde die Krankheit verschlimmern, bestätigte sich nicht – im Gegenteil: Nach den Injektionen ging es den Tieren sichtlich besser. Ihre Lähmungserscheinungen verringerten sich, und die Entzündungswerte wurden ebenfalls besser. Die Behandlung konnte sogar den Ausbruch der Krankheit verzögern, zeigten weitere Tests. Alzheimer bekamen die Mäuse von den Injektionen nicht: In ihren Gehirnen tauchten keinerlei Abeta-Plaques auf, berichtet das Team.