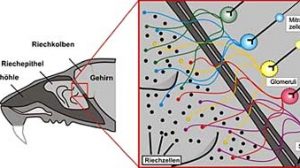Warum benutzen wir die räumlichen Begriffe „hoch“ und „tief“, um eine Tonlage zu beschreiben? Offenbar gibt es einen natürlichen Grund für diese Assoziation: Deutsche Neurowissenschaftler haben entdeckt, dass hohe Töne tatsächlich oft von höheren Positionen im Raum stammen. In einem Artikel im Fachmagazin „Proceedings of the National Academy of Sciences“ beschreiben sie auch, wie gut sich unser Ohr an diese Verhältnisse angepasst hat.
Manche Beschreibungen für Sinneseindrücke erscheinen willkürlich: Rote und gelbe Farben bezeichnen wir als „warm“, möglicherweise angelehnt an Feuer oder glühendes Metall, jedoch hat auch eisgekühlter Orangensaft eine warme Farbe. Den Geschmack von Chillischoten nennen wir „scharf“, obwohl die Schote mit einem Messer nichts gemeinsam hat.
Ähnlich willkürlich erscheint zunächst auch die Benennung von Tonfrequenzen: Wir unterscheiden zwischen „hohen“ und „tiefen Tönen, Noten werden entsprechend oben oder unten auf die Notenlinien geschrieben. Niemand käme auf die Idee, hohe Töne etwa als „schnell“ und tiefe als „langsam“ zu bezeichnen, obwohl das die Schwingungsfrequenzen sogar genauer beschreibt.
Zwitschern oben, bellen und grollen unten
Wissenschaftler aus Bielefeld und Tübingen haben untersucht, ob im Fall der Töne mehr hinter der Bezeichnung steckt als bloße Willkür. Dazu zeichneten sie zunächst eine große Anzahl von natürlichen Umgebungsgeräuschen auf und verglichen deren Frequenzen und die Position der Quelle miteinander.