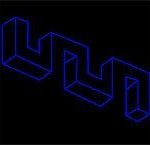Licht oder nicht?
Dieses Problem lösten die Forscher nun, indem sie eine Lichtquelle konstruierten, die bisher nur im Bereich der Quantenoptik und Quanteninformation zum Einsatz kam. Ein optischer Kristall bringt darin ein energiereiches Photon dazu, in zwei verschränkte Photonen niedrigerer Energie zu zerfallen. Im Versuch wurde jeweils eines der Photonen zum Auge der Versuchsperson geleitet, während das andere gleichzeitig auf einen Detektor traf.

Zwei verschränkte Photonen werden erzeugt, einer geht in einen Sensor,der andere ins Auge des Probanden. © IMP
Für den eigentlichen Test saßen die Probanden – junge Männer mit optimaler Sehfähigkeit – in einem lichtisolierten Raum und sollten nach einer Eingewöhnungsphase angeben, in welchem von zwei aufeinanderfolgenden Zeitintervallen sie glaubten, in der absoluten Dunkelheit ein Licht gesehen zu haben. Zudem sollten sie angeben, wie sicher sie sich jeweils waren. Insgesamt wiederholten die Forscher diesen Versuch mit verschiedenen Teilnehmern mehr als 30.000 Mal.
„Das ist kein Zufall mehr“
Das Ergebnis: Die Versuchsteilnehmer lagen in mehr als der Hälfte der Fälle richtig. Ihre Trefferquote war damit signifikant höher als bei reinem Zufall, wie die Forscher berichten. Werten die Forscher nur die Versuche, in denen sich die Probanden sehr sicher waren, stieg die Trefferquote sogar auf 60 Prozent.
„Das spricht dafür, dass das menschliche Auge tatsächlich imstande ist, ein einzelnes Photon zu erkennen“, sagt Varizi. „Das ist wirklich bemerkenswert und zeigt, bis zu welch erstaunlicher Effizienz die Evolution die Empfindlichkeit der Sinnesorgane vorantreiben kann – in diesem Fall bis zur Einheit der physikalischen Größe selbst.“
Was den Physiker besonders fasziniert: „Hier trifft ein Photon, die kleinste Einheit des Lichts, auf ein biologisches System, bestehend aus Milliarden von Zellen. Das extrem schwache Signal durchläuft mehrere Schritte biologischer Singnalverarbeitung bis hin zur bewussten Wahrnehmung und geht trotz aller möglichen Quellen des Rauschens nicht verloren.“
Rätselhafter „Priming“-Effekt
Wie sensibel die menschliche Netzhaut auf das Licht reagiert, hängt dabei offenbar nicht nur von individuellen Unterschieden ab. Wie ein weiteres Experiment ergab, stieg die Trefferquote der Probanden auch dann, wenn die Forscher zwei Einzelphotonen nacheinander mit maximal fünf Sekunden Abstand auf ihre Augen schickten.
„Wir vermuten, dass die Detektion eines einzelnen Photons vorübergehend die Sensibilität des Sehsystems für solche Ereignisse in extrem lichtarmen Bedingungen erhöht“, erklären die Wissenschaftler. Dieser sogenannte Priming-Effekt „eicht“ das Auge sozusagen darauf, auf besonders schwache Signale zu reagieren. Welche neurophysiologischen Mechanismen diesem Effekt zugrunde liegen, ist allerdings noch unbekannt.
Offen bleibt auch, wie das Sehsystem es schafft, das Signal nur eines Photons aus dem Hintergrundrauschen herauszufiltern. Alipasha Vaziri und sein Team wollen diesen Fragen in den kommenden Jahren auf den Grund gehen. (Nature Communications, 2016; doi: 10.1038/ncomms12172)
(Universität Wien/ Nature, 20.07.2016 – NPO)
20. Juli 2016