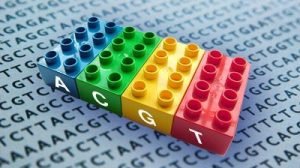Ziel verfehlt: Die Genschere CRISPR/Cas9 gilt als besonders präzises Werkzeug der Molekularbiologie. Doch die Methode ist nicht fehlerfrei, wie eine Studie nun eindrücklich zeigt. Demnach reparierte die Genschere bei Mäusen nicht nur die zuvor anvisierte Mutation – sondern löste zum Teil hunderte weitere Veränderungen aus. Das Brisante dabei: Gängige Algorithmen, die Forscher für die Vorhersage solcher möglichen Nebeneffekte nutzen, hatten die ungeplanten Mutationen nicht prognostiziert.
Wohl kaum ein molekularbiologisches Verfahren hat in den letzten Jahren so viel Furore gemacht wie die Genschere CRISPR/ Cas9. Kein Wunder, schließlich lassen sich mit dem Werkzeug erstmals buchstabengenaue Eingriffe in das Erbgut von fast jedem Organismus vornehmen. Hinzu kommt: Die Methode ist nicht nur so präzise wie keine vor ihr, die Modifikation der DNA wird damit auch besonders leicht und kostengünstig.
Seit der Veröffentlichung der Methode haben Forscher die Genschere immer wieder erfolgreich getestet und weiterentwickelt. So heilten sie mithilfe des Universalwerkzeugs unter anderem Mäuse von der erblich bedingten Muskeldystrophie Duchenne, korrigierten eine Alzheimer-Mutation in menschlichen Zellen und reparierten den Gendefekt der Sichelzellen-Anämie. Dank der vielversprechenden Resultate steht in China nun die erste klinische Studie in den Startlöchern, eine weitere soll kommendes Jahr in den USA beginnen.
Keine fehlerfreie Methode
Trotz der Euphorie funktioniert die Genschere jedoch keineswegs fehlerfrei. Manchmal löst sie Mutationen an Stellen des Genoms aus, die eigentlich unberührt bleiben sollten. Wissenschaftler nutzen deshalb Algorithmen, die vorhersagen, welche Regionen im Erbgut am wahrscheinlichsten von solchen Effekten betroffen sind – und schauen sich diese Bereiche dann genauer an. Kellie Schaefer von der Stanford University und ihre Kollegen warnen nun jedoch: Längst nicht alle ungewollten Veränderungen lassen sich mit diesem Verfahren aufspüren.