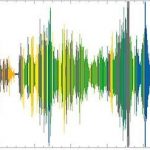Effektive Packstrategie: DNA-Stränge sind meterlang und passen doch in den winzigen Kern unserer Körperzellen – denn sie sind unglaublich dicht zusammengeknüllt. Das Geheimnis hinter solchen Verdichtungsprozessen haben Forscher nun am Beispiel von Drähten genauer untersucht. Ihre Ergebnisse zeigen, welche Eigenschaften eine möglichst dichte Packung von quasi-eindimensionalen Objekten ermöglichen. Interessant könnte das sowohl für Anwendungen in der Industrie als auch in der Medizin sein.
Wie muss man Gegenstände schichten, damit der Raum optimal genutzt wird? Vor 400 Jahren dachte darüber bereits der Mathematiker Johannes Kepler nach und formulierte seine Hypothese über die effektivste Methode, Kanonenkugeln auf einem Schlachtschiff zu stapeln. Seitdem haben Wissenschaftler immer wieder über die maximal erreichbare Verdichtung von Objekten nachgegrübelt.
Wie so oft macht die Natur in vielen Fällen vor, wie es geht. So befindet sich zum Beispiel unser gesamtes Erbgut in Form eines meterlangen DNA-Stranges dicht gepackt im winzigen Kern jeder Körperzelle. Wie effektiv sich solche quasi-eindimensionalen Objekte zufällig zusammenfalten, haben Physiker um Reza Shaebani von der Universität des Saarlandes nun genauer untersucht – anstelle von kettenförmigen DNA-Molekülen experimentierten sie dabei mit Drähten.
Knüllexperimente mit Draht
Für ihre Versuche verstauten die Forscher unterschiedlich dicke Plastikdrähte mit variabler Elastizität und Reibung in einer runden Kapsel. Um zu erfassen, wie stark sich die Drähte beim Verpacken zusammenknüllen, wurde die jeweils im Endzustand erreichte Packungsdichte gemessen.