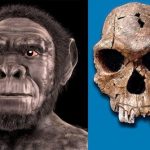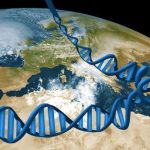Das Besondere an den Abdrücken: Ihre Form und Anordnung sind verblüffend menschenähnlich. „Sie müssen von einem zweibeinig laufenden Wesen hinterlassen worden sein, denn es fehlen Abdrücke von Vordergliedmaßen“, berichten die Forscher. In den einzelnen Fußspuren sind fünf nach vorne gerichtete Zehenabdrücke mit einer besonders großen ersten Zehe zu erkennen. Die Sohle ist eher länglich herzförmig und endet in einer schmalen, tiefer eingesenkten Fersenregion.

Verblüffend menschenähnlich: Die Form der Zehen und Sohle sowie die Ferse könnten für einen frühen Homininen als Urheber sprechen. © Andrzej Boczarowski
Kein Bär und auch kein Affe
Wer aber hinterließ vor 5,7 Millionen Jahren diese Spuren? Weil der Urheber auf zwei Beinen lief, scheiden viele Raubtiere und Affenarten aus. Auch der damals im Mittelmeerraum verbreitete Primat Oreopithecus bambolii passt nicht ins Bild, weil er zwar streckenweise aufrecht lief, aber eine noch deutlich abgespreizte Großzehe besaß, wie die Forscher erklären. Ein Bär könnte zwar kurze Zeit auf den Hinterbeinen gegangen sein, doch seine Spuren haben eher gleichgroße Zehen und müssten Abdrücke von Klauen zeigen.
Wer aber war dann der Urheber der Abdrücke? Nach Ansicht der Forscher muss ein bisher unbekannter früher Hominine diese Abdrücke hinterlassen haben: „Die Fußspuren von Trachilos haben größere anatomische Gemeinsamkeiten mit den Homininen als mit allen anderen Primaten, die wir zum Vergleich herangezogen haben“, berichten sie.
Menschenvorfahren auch in Europa?
Das aber bedeutet: Es könnte schon vor 5,7 Millionen Jahre frühe Vormenschen im europäischen Mittelmeerraum gegeben haben. „Wenn der Urheber der Trachilos-Fußspuren tatsächlich ein früher Hominine war, dann hätte dies beträchtliche Konsequenzen für unsere Vorstellungen der frühen Biogeografie der Menschenvorfahren“, konstatieren Ahlberg und seine Kollegen. Denn die Wiege der Menschheit könnte dann bis in den Mittelmeerraum gereicht haben.
„Unsere Entdeckung ist in jedem Fall eine Herausforderung für die etablierte Lehrmeinung der frühen menschlichen Evolution – und sie wird sicher eine Menge Diskussionen auslösen“, sagt Ahlberg. „Ob die wissenschaftliche Gemeinschaft Fußspuren als schlüssigen Beleg für die Präsenz von Homininen auf Kreta akzeptieren wird, bleibt abzuwarten.“ Zumindest existieren mit Graecopithecus und den neuentdeckten Fußspuren nun schon zwei Hinweise auf Vormenschen in Europa.
Günstiges Klima
Gestützt werden könnte dieses Szenario vom damaligen Klima: Während heute die Sahara wie eine Barriere wirkt, war dies vor knapp sechs Millionen Jahren noch nicht der Fall. Damals erstreckte sich noch eine ausgedehnte Savanne über ganz Nordafrika bis in das östliche Mittelmeergebiet. Sie könnte daher einen günstigen, zusammenhängenden Lebensraum für die frühen Homininen gebildet haben.
Hinzu kam: Weil damals die Meerenge von Gibraltar verschlossen war, sank der Meerspiegel im Mittelmeer immer weiter ab. Inseln wie Kreta waren dadurch mit dem Festland verbunden. Dies macht es plausibel, dass aus dem Süden entlang der Mittelmeerküste einwandernde Vormenschen auch Kreta erreichten.
In jedem Fall demonstriert die Entdeckung der Fußspuren, dass die frühe Evolution unserer Vorfahren noch einige Überraschungen in petto haben könnte. Welche Vormenschen sich wann und wo entwickelten, ist bisher erst in Ansätzen bekannt – es gibt einfach noch zu wenige Fossilien und Relikte. (Proceedings of the Geologists‘ Association, 2017; doi: 10.1016/j.pgeola.2017.07.006)
(Uppsala University, 04.09.2017 – NPO)
4. September 2017