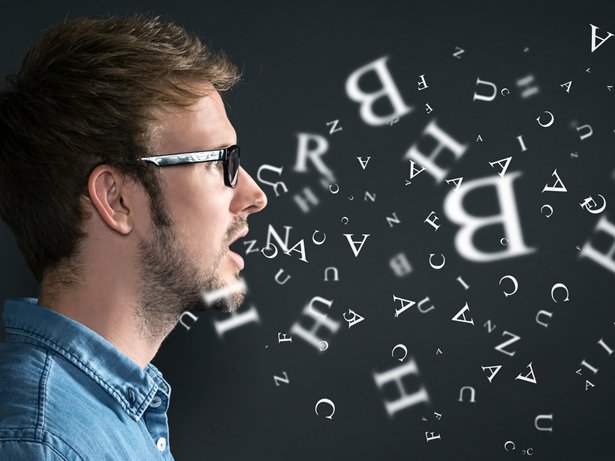Der Ursache des Stotterns auf der Spur: Forscher haben herausgefunden, dass ein überaktives Netzwerk im vorderen Bereich des Gehirns eine wesentliche Rolle beim Stottern spielen könnte. Es hemmt die Betroffenen darin, Sprechbewegungen vorzubereiten und auszuführen, indem es eine Art Stoppsignal sendet. Als Folge gelingt das flüssige Sprechen nicht mehr.
Rund jedem hundertsten Erwachsenen und jedem zwanzigsten Kind unter zwölf Jahren gelingt nicht, was den meisten von uns selbstverständlich erscheint: flüssig zu sprechen. Stattdessen ringen sie in alltäglichen Sprechsituationen mit den Wörtern, wiederholen krampfhaft den Anfang eines Wortes wie in „G-g-g-g-g-g-guten Tag“ oder bleiben an einzelnen Lauten mitten im Wort hängen, obwohl sie genau wissen, was sie sagen wollen.
Über die Ursachen dieses Stotterns ist bisher nur wenig bekannt. Frühere Studien haben zwar gezeigt, dass bei der Sprachstörung ein Ungleichgewicht zwischen der Hirnaktivität beider Hirnhälften auftritt: Eine Region im linken Stirnhirn ist viel zu schwach, die entsprechende Region in der rechten Hirnhälfte wiederum viel zu stark aktiviert.
Stotternden ins Gehirn geblickt
Wie diese veränderte Aktivität zustande kommt und was sie bewirkt, wussten Wissenschaftler bisher jedoch nicht. Um das herauszufinden, haben Nicole Neef vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig und ihre Kollegen nun Erwachsenen mithilfe der Magnetresonanztomografie (MRT) ins Gehirn geblickt, die seit ihrer Kindheit stottern.