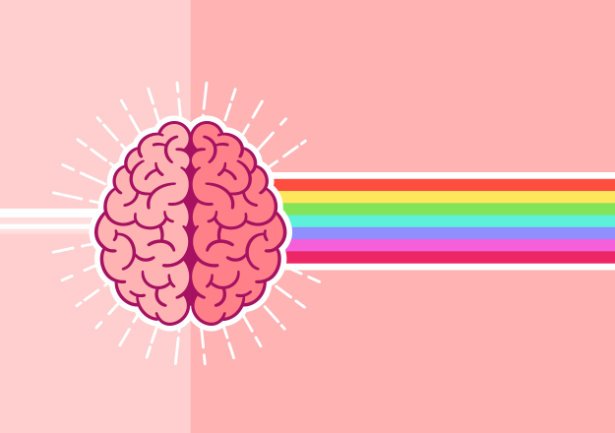Kaum messbar: Ob wir gerade ein intensives Glücksgefühl erleben, sieht man unserem Gehirn nicht unbedingt an. Denn die Ausschüttung des Glückshormons Dopamin lässt sich mit gängigen MRT-Verfahren nicht nachweisen. Zu dieser überraschenden Erkenntnis kommt nun eine Studie mit Ratten. Demnach zeigen sich nach einer Belohnung zwar veränderte Aktivitätsmuster im Gehirn, diese gehen jedoch nicht auf den Effekt des Dopamins zurück – ein Ergebnis, das sich künftig unter anderem auf die Diagnose von Erkrankungen wie Depressionen auswirken könnte, wie die Forscher betonen.
Das als Glückshormon bekannte Dopamin ist ein wichtiger Botenstoff unseres Nervensystems. Es spielt unter anderem im Belohnungssystem eine zentrale Rolle – und wird zum Beispiel dann ausgeschüttet, wenn sich ein Schüler über eine 1 in Mathe freut. Bei Krankheiten wie Depressionen, Parkinson oder Suchterkrankungen ist dieses hirneigene Belohnungssystem gestört – sie gehen oftmals mit Veränderungen im Dopaminspiegel oder einer mangelhaften Funktion dieses Neurotransmitters einher.
Mediziner untersuchen solche Veränderungen oftmals mithilfe der funktionellen Magnetresonanztomografie (fMRT). Dabei werden Durchblutungsänderungen von Hirnarealen gemessen, die auf Stoffwechselvorgängen und neuronaler Aktivität beruhen. Doch ist diese Methode wirklich gut geeignet, um die Ausschüttung des dem Glücksgefühl zugrundeliegenden Dopamins zu beobachten? Dieser Frage sind nun Michael Lippert vom Leibniz-Institut für Neurobiologie in Magdeburg und seine Kollegen nachgegangen.
Kaum messbare Effekte
Für ihre Studie arbeiteten sie mit genetisch veränderten Ratten, bei denen die Dopaminausschüttung im Gehirn gezielt mithilfe von Licht gesteuert werden kann. Im Experiment konnten sich die Nager selbst belohnen: Drückten sie einen Hebel, ließen spezielle Lichtimpulse die Dopamin-ausschüttenden Zellen feuern. „Dabei wird ein extremer Belohnungsreiz ausgelöst“, erklärt Lipperts Kollegin Marta Brocka.