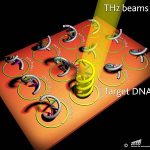Zwischen den derzeit im Schwarzwald lebenden Populationen von Auerhühnern gibt es nur noch einen geringen Austausch von Genen. Dies hat ein internationales Wissenschaftlerteam jetzt herausgefunden. Ursache dafür ist vermutlich vor allem die zunehmende Zerstückelung des Lebensraumes der Tiere, schreiben die Forscher in der aktuellen Online-Ausgabe der Fachzeitschrift „Molecular Ecology“.
Die genetische Vielfalt einer natürlichen Population ist abhängig von deren Größe: Um eine gewisse Vielfalt an Genen für eine überlebensfähige Population bereit zu halten, ist eine Mindestanzahl von Tieren nötig. Was passiert jedoch dann, wenn die Bestandszahlen bestimmter Arten drastisch zurückgehen? Um das herauszufinden, haben Gernot Segelbacher vom Max-Planck-Institut für Ornithologie und seine Kollegen von der Universität Tübingen und der Université Joseph Fourier im französischen Grenoble die genetische Vielfalt von historischen und noch lebenden Auerhühnern miteinander verglichen.
Die Anzahl der Auerhühner im Schwarzwald hat durch die Zerstörung von geeignetem Lebensraum in den letzten Jahrzehnten rapide abgenommen. Auerhühner haben spezielle Ansprüche an ihren Lebensraum und kommen daher nur noch in einzelnen, isolierten Waldfragmenten vor. Gab es zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch circa 4.000 Männchen, so ist deren Zahl in den 1980er-Jahren auf 500 und bis 2003 sogar auf nur noch rund 250 Männchen gesunken.
Nur ein Tier pro Quadratkilometer
Die durchschnittliche Populationsgröße im Schwarzwald wird zurzeit auf ein Tier pro Quadratkilometer geschätzt. So ein dramatischer Populationsrückgang sollte auf lange Sicht Auswirkungen auf die genetische Struktur der Tiere haben.