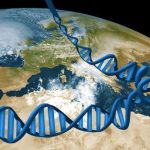Auslandsreisen und kontinentweite Handelsbeziehungen sind keineswegs eine Erfindung der Neuzeit: Die DNA eines Arabers in einem eisenzeitlichen Grabhügel deutet darauf hin, dass auch die Skandinavier vor 2.000 Jahren schon in häufigem Kontakt mit dem „Rest der Welt“ standen. Neue Analysen haben die Mär von der genetisch und kulturell reinen „Herrenrasse“ nun widerlegt.
Im südlichen Teil der dänischen Insel Seeland liegen zwei bekannte eisenzeitliche Grabstätten, Bøgebjerggård und Skovgaarde. Beide gehen auf die Zeit vor 2.000 bis 1.600 Jahren zurück. Wissenschaftler der Universität von Kopenhagen um Linea Melchior haben nun 18 der dort begrabenen Leichen genetisch analysiert und dabei überraschende Entdeckungen gemacht.
Die mitochondriale DNA der historischen Leichen, Erbsubstanz, die ausschließlich über die mütterliche Linie weitervererbt wird, war erheblich variantenreicher als gedacht. Ihre genetische Diversität glich eher der, die man aus unserem modernen Zeitalter der Globalisierung und Mobilität erwarten würde. Auch in weiteren Gräbern bestätigte sich dieser Eindruck. „Keines der Individuen scheint mütterlicherseits miteinander verwandt zu sein“, erklärt Melchior. „Wir konnten keine großen Familien nahe beieinander in einer Grabstätte finden. Das deutet darauf hin, dass die Menschen auch in der dänischen Eisenzeit nicht unbedingt im Dorf ihrer Geburt blieben bis sie starben, wie wir es zuvor angenommen haben.“
Keine isolierte „Herrenrasse“
Ungewöhnlich war auch die Entdeckung eines Mannes, dessen genetische Ausstattung auf eine Herkunft aus dem arabischen Raum hindeutet. Unter anderem wegen solcher Funde gehen Archäologen und Anthropologen heute davon aus, dass die Skandinavier keineswegs ein genetisch und kulturell isoliertes Volk waren, wie gerne auch in früheren Vorstellungen einer „skandinavischen Rasse“ postuliert.