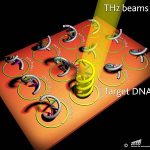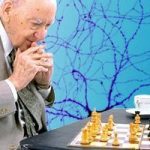Die Neuronen dieser Region bilden Dopamin, einen Botenstoff, der Signale in jene Hirnregionen übermittelt, welche die Bewegungen koordinieren. Wenn die Dopamin produzierenden Neuronen zugrunde gehen, können die Hirnregionen, die Bewegungen kontrollieren, nicht mehr normal arbeiten. Die Folge sind zittrige Hände und verlangsamte Bewegungen. Die derzeitigen Medikamente, die zur Behandlung der Krankheit eingesetzt werden, erhöhen die Dopaminspiegel im Gehirn, können aber Nebenwirkungen haben. Dies soll Kiriks Gentherapie verhindern.
Kirik schleust zwei Gene mit Hilfe eines entschärften, nicht mehr vermehrungsfähigen Virus in das Gehirn. Dort befällt es Hirnzellen und lädt die beiden neuen Gene ab. Diese produzieren dann die Enzyme TH und GCH1, die sich mit einem anderen, bereits in den Hirnzellen vorhandenen Enzym (AADC) verbinden und das Dopamin in jenen Regionen des Gehirns produzieren, wo es benötigt wird. „Die Enzyme werden in Hirnzellen produziert und helfen dem Patienten, selbst wieder Dopamin auszuschütten“, erläutert Kirik.
Viren nicht mehr vermehrungsfähig
Hirnzellen mit einem Virus zu infizieren, mag gefährlich klingen, aber der Forscher hat sie speziell für diese Aufgabe entschärft. „Diese viralen Vektoren“, sagt Kirik, „sind so konstruiert, dass sie sich nicht mehr vermehren können und keine Krankheiten auslösen.“ Das Virus, das Kirik als Genfähre einsetzt, ist das Adeno-assozierte Virus (AAV), das den Menschen nicht krankmacht. „In dieser Hinsicht ist dieser Virusvektor als erstes einmal sicher“, sagt Kirik.
Die Viren werden gereinigt und konzentriert und dann in jene Hirnregionen injiziert, in denen normalerweise Dopamin produziert wird. „Die Dopamin-Neuronen“, erklärt Kirik, „befinden sich anderen Region des Gehirns, in der Substantia nigra. Sie senden ihre Fortsätze (Axone) aber in das Striatum und schütten dort das Dopamin aus. Wir schleusen die Gene in eine andere Hirnzellpopulation, die sich in der Zielregion – dem Striatum – befinden. Die Zellen werden so zu kleinen Minipumpen für Dopamin.“
Behandlung wirkt lange
Das wichtige an diesem neuen Gentherapieansatz ist, dass die Behandlung lang wirken könnte. „Wenn der Vektor einmal in der Zelle ist“, erklärt Kirik, „werden die Gene in die Zelle geschleust, wo sie ständig verbleiben.“ Und die Ergebnisse sehen vielversprechend aus, sagt er: „Wir gehen davon aus, dass diese Therapie für mindestens fünf Jahre – wahrscheinlich länger – wirkt, wie unsere Studien mit Nagern und Affen gezeigt haben.“
Bessere Behandlung, bessere Lebensqualität
Das könnte ein großer Schritt nach vorn für die Behandlung der Parkinson-Krankheit sein, denn eine große Zahl von Patienten, die schon viele Jahre an dieser Erkrankung leidet, kommt in die Phase, in der sie nicht mehr gut auf die derzeit zur Verfügung stehenden Therapien anspricht. „Obwohl sie dann noch fünf, zehn, 15 Jahre leben können“, sagt Kirik, „sind die Behandlungsmöglichkeiten begrenzt. Diesen Patienten können wir eine bessere Behandlung und eine bessere Lebensqualität bieten.“
Kirik und seine Mitarbeiter werden diesen Therapieansatz als nächstes in weiteren Studien an Primaten prüfen und hoffen, in drei Jahren mit Studien an Patienten beginnen zu können.
Andere Forschergruppen arbeiten mit einer ähnlichen Technik wie Kirik, setzen aber unterschiedliche Genkombinationen ein. So arbeitet eine Gruppe mit drei Korrektur-Genen, eine andere mit nur einem Gen. „Welcher dieser verschiedenen Ansätze letztlich der überlegene sein wird“, sagt Kirik, „werden erst klinische Versuche zeigen können, da die Tierversuche nicht den letzten Ausschlag geben können.“
(ProScience Communications, 16.07.2008 – DLO)
16. Juli 2008