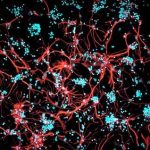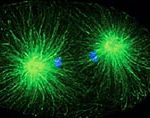„Ohren wie ein Luchs“: So sagt man zu Menschen, die besonders gut hören können. Doch damit könnte es schon bald vorbei sein – zumindest, wenn man auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse über die Ähnlichkeit der Hörvorgänge Rücksicht nimmt. Dann müsste es künftig heißen: „Ohren wie die Fliegen“. Denn Wissenschaftler haben herausgefunden, dass unser Ohr beinahe genauso funktioniert wie das einer Fruchtfliege.
Björn Nadrowski konnte zusammen mit seinen Kollegen von der Universität Köln in der Fachzeitschrift „Current Biology“ zeigen, dass – bei allen äußerlichen Unterschieden der Organe – die Mechanik des Hörvorgangs bei Mensch und Fliege Drosophila melanogaster überraschend einheitlich ist. Mit Hilfe des Modellorganismus wollen die Kölner Forscher nun die molekularen Abläufe des Hörens im Detail aufklären.
Das Fliegenohr steht am Zoologischen Institut der Universität Köln seit 2003 im Mittelpunkt, als Martin Göpfert dort eine Nachwuchsgruppe der VolkswagenStiftung zum Thema aufbaute. Er erkannte früh die Ähnlichkeit der Hörmechanismen von Mensch und Fliege und nutzte sie, um den genauen Abläufen der Reizverstärkung im Ohr auf die Spur zu kommen. Die Erkenntnisse können dabei helfen, derzeitige Hörgeräte zu verbessern, deren Leistungen noch weit davon entfernt sind, das natürliche akustische Empfinden nachzubilden – eine wichtige Aufgabe bei schätzungsweise 14 Millionen Deutschen mit eingeschränktem Hörvermögen und in einer immer älter werdenden Gesellschaft.
Ionenkanal bringt Fliegen-Antennen zum Wackeln
Dabei interessierten sich die Wissenschaftler besonders dafür, wie der Schall im Innern des Ohrs über Ionenkanäle in elektrische Signale umgewandelt wird. Gemeinsam mit dem Biologen Jörg T. Albert und dem Physiker Björn Nadrowski konnten die Kölner Forscher eine nicht-invasive Messmethode entwickeln, die diesen Vorgang nach außen sichtbar macht: Öffnet sich der Ionenkanal, wackelt die Fliege mit den Antennen – nicht mit dem Auge sichtbar, aber mit einer Messapparatur nachzuweisen.