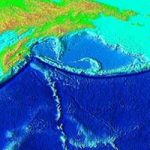Der Meeresgrund besteht zum Großteil aus Schlamm. Daher wird alles, was niet- und nagelfest ist – Riffe, Treibholz, Walknochen –, sofort von unterschiedlichsten Organismen erobert. Das kann auch schon mal ein bunter Topfreiniger aus Plastik sein, den österreichische Meeresbiologinnen am Ostpazifischen Rücken im Südpazifik versenkt haben. Sie untersuchen auf diese Weise die Neubesiedlung des Tiefseelebensraums nach einem vernichtenden Vulkanausbruch.
{1r}
Ursprünglich hatten Monika Bright und Sabine Gollner von der Fakultät für Lebenswissenschaften der Universität Wien geplant, die Rolle von kleinen Organismen wie Fadenwürmer, winzige Ruderfußkrebse oder Foraminifera, die am Grunde des Meeres leben, im Nahrungsnetz entlang heißer Tiefseequellen und vulkanischer Krater am Ostpazifischen Rücken zu studieren. Dieses Projekt zur Erforschung der so genannten Meiofauna wurde aber im Januar 2006 jäh durchkreuzt: Ein heftiger, unterseeischer Vulkanausbruch löschte jegliches Leben im Untersuchungsgebiet auf einen Schlag aus.
„Stunde Null“
Im Nachhinein entpuppte sich das einschneidende Naturereignis jedoch als einmalige wissenschaftliche Gelegenheit: „Wir haben dadurch zum ersten Mal in der Geschichte der Meeresbiologie die Möglichkeit bekommen, die Besiedlung eines marinen Lebensraums von Stunde Null an zu dokumentieren“, sagt Bright: „Wir haben die Chance genutzt und unser Projekt kurzerhand umkonzipiert.“