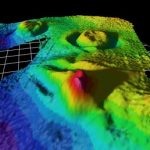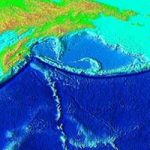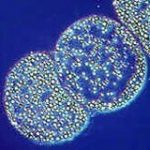Ein Leben ohne Sauerstoff – nicht nur für Menschen, auch für die meisten marinen Organismen ist das unmöglich. Vor allem in den tropischen Ozeanen existieren jedoch Zonen, in denen diese wichtige Lebensgrundlage Mangelware ist. Die weltweit größte „Sauerstoffminimumzone“ erstreckt sich im Ost-Pazifik vor den Küsten Perus und Ecuadors. Sie war Ziel einer viermonatigen Expedition von Kieler Meereswissenschaftlern mit dem Forschungsschiff METEOR. Eine der zentralen Fragen der Forscher: Verändern sich diese Zonen als Folgen des Klimawandels? Ende Februar kehrte das letzte Team mit einer Fülle neuer Daten an die Förde zurück.
Trügerische Fülle
Delfine, Wale, Seelöwen – auf den ersten Blick scheinen die Küstengewässer Perus vor Leben zu wimmeln. Doch der Eindruck täuscht. Denn nur wenige Meter unter der Wasseroberfläche beginnt eine lebensfeindliche Zone, in der kaum Sauerstoff vorhanden ist. „Südlich von Lima haben wir nahe der Küste extrem sauerstoffarme Bedingungen vorgefunden. Es wurde Schwefelwasserstoff in der Wassersäule festgestellt und schon fünf Meter unter der Wasseroberfläche gab es keinen freien Sauerstoff mehr“, erläutert Professor Martin Frank, einer von vier wissenschaftlichen Fahrtleitern aus Kiel, die in den vergangenen Monaten mit der METEOR vor Südamerika unterwegs waren. Sein Kollege Lothar Stramma erklärt den Widerspruch zur scheinbaren Üppigkeit des Lebens in der Region: „Die großen Meeressäuger finden nur in den obersten Metern des Ozeans Nahrung. Deshalb sind sie so häufig zu sehen“.
Vergrößern sich die „Todeszonen“?
Sauerstoff ist für das Leben auf der Erde von elementarer Bedeutung – nicht nur an Land, sondern auch im Meer. Anders als in der Atmosphäre ist die Sauerstoffverteilung im Wasser jedoch nicht gleichmäßig. Es gibt sauerstoffarme Zonen, die für die marine Lebewelt zum Problem werden können. Solche Zonen existieren im Ostatlantik, im nördlichen Indischen Ozean und im tropischen Ost-Pazifik. Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass sich diese Gebiete infolge des Klimawandels sogar noch vergrößern könnten. Das hätte Auswirkungen auf chemische und mikrobiologische Prozesse im Ozean, die sich auf den Nährstoffhaushalt auswirken würden und massive Änderungen im marinen Ökosystem zur Folge haben könnten.
Der Kieler Sonderforschungsbereich „Klima – biogeochemische Wechselwirkungen im tropischen Ozean“ hat sich dieses Phänomens angenommen und eine viermonatige Expedition in die weltweit größte Sauerstoffminimumzone im Ost-Pazifik durchgeführt. Von Mitte Oktober 2008 bis Februar 2009 waren insgesamt vier Teams von Geologen, Geochemikern, Ozeanographen, Biologen und Meteorologen mit dem deutschen Forschungsschiff METEOR unterwegs und haben mit Hilfe physikalischer, chemischer und biologischer Messungen eine Fülle neuer Daten über die Sauerstoffminimumzone gewonnen.