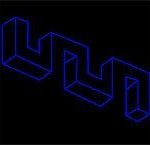Selbst wenn sich die Lichtverhältnisse plötzlich ändern, behalten wir die wesentlichen Strukturen unserer Umwelt im Blick. Lange schon ist bekannt, dass wir dabei senkrechte Kanten besser erkennen können als schräge. Jetzt haben Neurowissencshaftler herausgefunden, warum. In der Fachzeitschrift „European Journal of Neuroscience“ berichten sie über ihre Experimente.
In der primären Sehrinde des Gehirns findet man Nervenzellen, die aus Bildern bestimmte Basisinformationen extrahieren. Beispielsweise reagieren Zellen selektiv auf Kanten oder Linien einer bestimmten Orientierung. Nervenzellen mit ähnlichen Antworteigenschaften sind dabei eng benachbart und bilden sich wiederholende Cluster, die entlang der Oberfläche zu Orientierungskarten organisiert sind. In den 90er Jahren fanden Wissenschaftler heraus, dass größere Bereiche in diesen Karten bevorzugt vertikale Bildkonturen verarbeiten. Schräge Kanten werden daher weniger deutlich registriert.
Bekannt war auch, dass die Mechanismen zur Erzeugung dieses Oblique-Effekts bereits auf frühen Stufen der Bildverarbeitung im Gehirn wirksam sind. Schon in der primaären existieren mehr Nervenzellen zur Verarbeitung vertikaler Reize. Solche selektiven Leistungen des Gehirns wurden durch Anpassungen an die größere Häufigkeit von vertikalen Konturen in der natürlichen Umwelt erklärt. Wissenschaftler der Ruhr-Universität Bochum (RUB) um Dirk Jancke haben dieses Phänomen nun mit einer neuen Analysemethode untersucht.
Was passiert bei Änderungen des Bildkontrastes ?
Sie wollten wissen, inwieweit diese Funktion vom Bildkontrast beeinflusst ist. In einem Experiment präsentierten sie Probanden auf einem Bildschirm unterschiedlich orientierte Gittermuster und variierten dabei den Kontrast. Währenddessen maßen sie die Aktivität der Nervenzellen in der primären Sehrinde. Es zeigte sich, dass die Orientierungskarten im Gehirn und damit der Oblique-Effekt konstant sind.
„Wenn Sie plötzlich mit dem Auto in Nebel geraten, möchten Sie, dass Ihr Gehirn weiterhin die wichtigsten Information liefert, dass also die wesentlichen Verarbeitungsmechanismen stabil bleiben“ erklärt Jancke den Vorteil des Effekts. „Spannend wird sein, inwiefern der Oblique-Effekt von der Wahl der Bildreize abhängt. Bislang nutzen wir einfache Gitterreize um den Parameter Orientierung selektiv zu kontrollieren. In Zukunft werden wir komplexere Reize verwenden, um den natürlichen Bedingungen, unter denen unser Sehsystem arbeitet, näher zu kommen.“
Gehirnaktivität optisch gemessen
Die Arbeitsgruppe nutzte dabei ein optisches Verfahren, um die Nervenzellaktivität zu messen. Dabei werden Änderungen des Sauerstoffgehalts im neuronalen Gewebe detektiert. Werden Nervenzellen aktiv, verbrauchen sie Sauerstoff. Die dadurch bedingte Verminderung der Sauerstoffkonzentration im Blut reduziert die von einer hochempfindlichen Kamera detektierte Photonendichte um wenige Zehntausendstel. Im Bild werden diese Signale nach einigen Rechenoperationen als lokal abgedunkelte Bereiche im Gehirn sichtbar.
„Der Vorteil ist, dass man auf diese Weise weitreichende Gehirnregionen und damit die Aktivität von Millionen von Nervenzellen gleichzeitig untersuchen kann“, erklärt Dirk Jancke, der im Rahmen seiner Juniorprofessur „Kognitive Neurobiologie“ das „Optical Imaging Labor“ an der Fakultät für Biologie und Biotechnologie der RUB etabliert hat. Seiner Mitarbeiterin Dr. Agnieszka Grabska-Barwi?ska gelang in einem nachfolgend von ihr entwickelten, aufwendigen Analyseverfahren nun der Nachweis, dass Orientierungskarten weitgehend unabhängig vom Kontrast sind und so den kortikalen Oblique-Effekt
stabilisieren.
(Ruhr-Universität Bochum, 24.03.2009 – NPO)