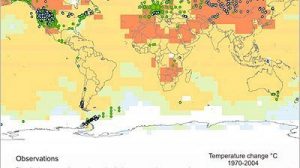Sie heißen Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sofie und können uns den Frühling im wahrsten Sinne des Wortes verhageln: die Eisheiligen. Doch die frostigen „Gesellen“ treten heute deutlich seltener auf als noch vor hundert Jahren. Dies zeigen die Aufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD).
Mit dem Begriff Eisheilige wird der Zeitraum vom 11. bis zum 15. Mai bezeichnet, in dem bis Mitte des 19. Jahrhunderts fast regelmäßig Kaltlufteinbrüche beobachtet wurden. Schuld an den ungemütlichen Temperaturen sind Nord-Wetterlagen, die arktische Polarluft nach Mitteleuropa führen. Die Eisheiligen bekamen ihre Namen von frühchristlichen Bischöfen und Märtyrern, denen an diesen Maitagen gedacht wird.
In Norddeutschland gelten die Tage vom 11. bis 13. Mai als Eisheilige – Mamertus, Pankratius und Servatius. Im Süden und Südosten Deutschlands zählen noch der 14. (Bonifatius) und der 15. Mai (kalte Sofie) dazu. Hier ist der 11. Mai allerdings nicht gültig. Die eintägige Differenz erklärt sich laut DWD aus dem Zeitraum, den die Kaltluft bei Eintritt der Nord-Wetterlagen benötigt, um von Norden nach Süden vorzudringen.
Obstbäumen drohen Frostschäden
Die kalte Luft, die in ungünstigen Lagen auch manchmal Frost bringen kann, bereitet dann vor allem Gärtnern und Winzern schlaflose Nächte, denn an den Obstbaumblüten können Frostschäden schon bei geringen Kältegraden eintreten. Obstblüten sind um so mehr gefährdet, je näher sie sich dem Erdboden befinden, da sich in windstillen und wolkenarmen Frühlingsnächten die kälteste Luft in unmittelbarer Bodennähe bildet und in Geländevertiefungen zusammenfließt.