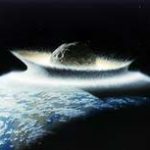„Wenn wir dieses Kleinod der Natur vor der Katastrophe retten wollen, sind sofortige, einschneidende Maßnahmen unumgänglich“, sagte der Hauptautor der Studie Joseph Ogutu, ein Umweltstatistiker des „International Livestock Research Institute“ (ILRI) und Fellow der Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH) an der Universität Hohenheim in Stuttgart. „Unsere Studie liefert die bisher tragfähigsten Beweise dafür, dass die Wildtierverluste im Reservat weit verbreitet und von erheblichem Umfang sind und dass diese Entwicklung wahrscheinlich mit der stetigen Zunahme menschlicher Ansiedlungen auf unmittelbar neben dem Reservat liegendem Land verknüpft ist.“
Siedlungen rund um das Reservat nehmen zu
Die Forscher haben herausgefunden, dass die wachsende menschliche Bevölkerung den Wildtierbestand dadurch verringert, dass sie die Weidegründe der Tiere für Ackerbau und Viehzucht zur Ernährung ihrer Familien beansprucht. Einige traditionelle Agrarkulturen westlich und südwestlich der Mara betreiben noch immer die mittlerweile verbotene Jagd nach wilden Tieren im Mara-Reservat – zum Nahrungserwerb sowie aus Gewinnstreben.
Ogutu und seine Kollegen richteten ihr Augenmerk hauptsächlich auf die raschen Veränderungen in den ausgedehnten Territorien rund um den Mara Nationalpark. Diese als Mara Ranchlands bekannten Gebiete sind die Heimat der Massai. Bis vor kurzem waren die meisten Massai halbnomadische, für ihre kriegerische Kultur und ihre rote, togaartige Kleidung bekannte Hirten, die mit den wilden Tieren in der Region friedlich zusammenlebten.
Doch im Verlauf der letzten Jahrzehnte haben einige Massai ihre traditionellen Dörfer aus Lehm, Dung und Ästen, die so genannten Bomas, verlassen. Jetzt zieht es sie in dauerhaftere Siedlungen an die Grenzen des Reservats. So berichten Ogutu und seine Kollegen, dass in nur einem der an den Nationalpark angrenzenden Ranchlands, der Koyiaki Ranch, die Zahl der Bomas von 44 im Jahr 1950 auf 368 im Jahr 2003 angestiegen ist. Gleichzeitig stieg die Zahl der Hütten von 44 auf 2.735. Die Untersuchung ergab, dass mit Ausnahme der Wasserböcke und Zebras alle Arten in dem Maße signifikant zurückgegangen sind, wie die Anzahl der dauerhaften Siedlungen rings um das Reservat zugenommen hat.
„Die Tiere wandern ständig zwischen dem Reservat und den umliegenden Ranchlands hin und her. Dabei müssen sie zunehmend mit den rings um die menschlichen Siedlungen anzutreffenden Viehherden und ausgedehnten Anbauflächen um ihren Lebensraum konkurrieren“, führt Ogutu aus. „Unsere Untersuchungen haben insbesondere ergeben, dass immer mehr Bewohner der Ranchlands ihr Vieh im Reservat grasen lassen. Die verarmten Massai nehmen zu dieser illegalen Praxis Zuflucht, wenn sie sich mit langen Dürreperioden konfrontiert sehen oder mit anderen Problemen zu kämpfen haben.“
Wildtier-Tötung als Vergeltung
Darüber hinaus weist die Studie warnend darauf hin, dass Tötungen von Wildtieren als Vergeltung für eingerissene Zäune, beschädigte Ernten, geplünderte Wasservorräte oder angegriffenes Vieh in den Ranchlands „weit verbreitet sind und immer mehr zunehmen.“ Ogutu sagt, dass die zahlreichen Bedrohungen, denen der Wildtierbestand in den Ranchlands ausgesetzt ist, „schwerwiegende Konsequenzen“ für den Schutz der Tiere im Reservat haben könnten. Dies deshalb, weil die meisten wilden Tiere der Region aufgrund ihrer saisonalen Wanderungen zwischen dem Reservat und dem Umland zumeist außerhalb des geschützten Reservats weiden, also in den Ranchlands.
Obwohl sich ihre Untersuchung nicht damit befasst, legen die an der Studie beteiligten Forscher Wert auf den Hinweis, dass für den Übergang der Massai zu einem sesshafteren Lebensstil zum Teil eine jahrzehntelange Vernachlässigung durch die Politik verantwortlich ist. Vielen Massai blieb deshalb keine andere Wahl, als ihre umweltfreundliche, nachhaltige Methode des Weidens über ausgedehntes Grasland aufzugeben.
„Tipping Point“ erreicht
„Die traditionelle Tierhaltung der Massai, die nur selten wilde Tiere verzehren, förderte sogar den Erhalt des Reichtums der Weidetierarten in Ostafrika. Dort, wo noch ländliche Weidemethoden vorherrschen, profitieren die Wildtierbestände nach wie vor davon“, sagt Robin Reid, ein Co-Autor der Studie vom Center for Collaborative Conservation an der Colorado State University in den Vereinigten Staaten.
„Es scheint bei der menschlichen Bevölkerungszahl einen ‚Tipping Point‘ zu geben – also einen Umkipp-Punkt, jenseits dessen die vormalige Koexistenz der Massai mit den wilden Tieren nicht mehr möglich ist. In den Dörfern an der Grenze der Mara wurde dieser Punkt bereits überschritten, doch die Bevölkerungszahlen sind in großen Gebieten der Mara noch immer niedrig genug, um eine gegenseitige Verträglichkeit zu ermöglichen.“
Co-Existenz ist möglich
Interessanterweise haben andere Forschungsarbeiten von Reid und Ogutu ergeben, dass ein maßvolles Weiden von Vieh im Mara-Reservat für die Wildtiere ebenfalls von Vorteil sein kann. In der Regenzeit etwa, wenn das hohe und grobe, nährstoffarme Gras den Raubtieren Deckung bietet, bleiben viele grasende Wildtierarten dem Reservat fern. Dann grasen sie lieber in der Nähe traditioneller ländlicher Siedlungen, wo das den Herden der Viehalter zugedachte Gras nahrhaft und kurz ist und Raubtiere schon von Weitem sichtbar sind.
Reid fügt hinzu: „Diese auf den ersten Blick widersprüchlichen Ergebnisse werden mittlerweile von örtlichen Massai-Kommunen bei Versuchen zur Eindämmung von Wildtierverlusten berücksichtigt. Die Massai erkennen, dass die Wildtierbestände zurückgehen, wenn die Siedlungen zu zahlreich sind, dass sie andererseits jedoch von einer maßvollen Anzahl an Siedlungen profitieren können.“
Die Landbesitzer der Massai errichten gemeinsam mit den Touristik- Unternehmen Naturschutzzonen – Conservancies -, in denen sie die Anzahl der Siedlungen und den Umfang des Viehbestands sorgfältig regeln, um die dargestellte Balance zu erreichen. Einen Anreiz hierfür bietet den Massai die Tatsache, dass sie zum ersten Mal großzügig an den Einnahmen aus dem Tourismus auf ihrem Land beteiligt werden.
Kooperation von Massai, Reiseunternehmen und örtlichen Kommunen
Der Massai-Führer Dickson Kaelo arbeitet gemeinsam mit Reiseunternehmen und örtlichen Kommunen an der Gestaltung der Naturschutzzonen. Im neuen Olare Orok Conservancy machte man die Erfahrung, dass nach dem Abzug der Viehherden und Siedlungen die Wildtiere zunächst in großen Scharen in das Gebiet strömten.
„Doch bald wuchs das Gras in die Höhe, und viele Tiere wandten sich dem kürzeren Gras in der Nähe der Siedlungen jenseits der Naturschutzzone zu“, sagt Carlos Seré, der Generaldirektor des ILRI.
„Die Geschichte der vergangenen Jahrtausende hat uns gelehrt, dass ländliche Viehzucht und Ostafrikas berühmte Bestände an großen Säugetieren Seite an Seite existieren können. Bei unseren Versuchen, den gegenwärtigen Konflikt zu lösen, beziehen wir die ländlichen Hirten ein. Mit ihrer Hilfe, aber auch mithilfe der beträchtlichen, den Wildtieren der Mara zu verdankenden Tourismus-Einnahmen ist es möglich, in von Tatsachen untermauerte Strategien zu investieren, die sowohl die weltberühmten Hirtenvölker der Region als auch deren Wildtierpopulationen schützen können“, so Seré.
„Wildlife Conservation Lease Programme“
Eine weitere Umweltschutzinitiative, das „Wildlife Conservation Lease Programme“, wurde in den an den Nairobi-Nationalpark grenzenden Kitengela Rangelands eingeführt. Das Programm hält Hirtenfamilien, die auf Pachtland leben, mit Bargeldzahlungen dazu an, ihre Ländereien weder einzuzäunen noch zu entwickeln oder zu verkaufen.
Dieses von der Behörde der Vereinigten Staaten für internationale Entwicklung – United States Agency for International Development (USAID) – geförderte Programm hat bei der Erhaltung der Rangelands für Wild- und Herdentiere große Erfolge erzielt. Gleichzeitig stellt es für Massai-Familien eine bedeutende Einkommensquelle dar. Nach Ansicht des ILRI sollte das Programm auf die hier lebenden Familien ausgeweitet und auch in anderen ländlichen Ökosystemen bzw. Rangelands eingeführt werden.
„Uns liegen Beweise dafür vor, dass sich die enormen, in den letzten Jahren beobachteten Rückgänge bei den Wildtierpopulationen Ostafrikas durch eine Verbesserung der Lebensumstände der Massai sowie anderer Hirtenvölker, die ihre Herden in der Nähe geschützter Wildparks der Region weiden, verlangsamen lassen und Zusammenbrüche von Ökosystemen verhindert werden können“, sagte Seré abschließend. „Unsere Arbeit ist ein Beleg dafür, dass Wissenschaftler, Politiker und örtliche Kommunen gemeinsam diejenigen technischen Voraussetzungen und Anpassungsmöglichkeiten schaffen können, die erforderlich sind, um die ländlichen Ökosysteme und die von ihnen abhängigen Menschen selbst angesichts großer Veränderungen widerstandsfähiger zu machen.“
(idw – Universität Hohenheim, 22.05.2009 – DLO)
22. Mai 2009