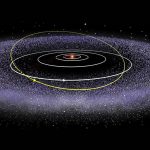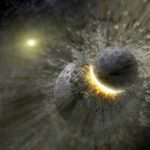Als Astronomen um Marco Delbo vom Observatorium der Côte d’Azur im Jahr 2017 eine gründliche Familien-Analyse der bekannten Asteroiden vornahmen, stießen sie auf 17 Asteroiden, die offenbar keinerlei Kollisionen erlebt hatten und sich noch in demselben Urzustand befanden wie bei der Entstehung des Sonnensystems.
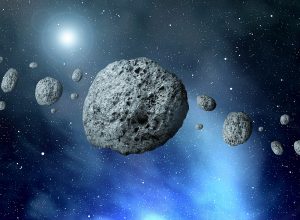
Rätselhafte Häufung bei 100 Kilometern
Diese primordialen Asteroiden, und damit vermutlich auch die ursprünglichen Planetesimale, haben eine vergleichsweise enge Größenverteilung. Objekte mit einem Durchmesser von etwa 100 Kilometern sind weitaus häufiger als größere oder kleinere Objekte, entsprechend einer sogenannten Gaußverteilung. Aber warum die 100 Kilometer? Was ist das Besondere an diesem Maßstab?
An dieser Stelle kommt die Forschung von Hubert Klahr ins Spiel. Klahr ist Leiter der Theoriegruppe in der Abteilung Planeten- und Sternentstehung am Max-Planck-Institut für Astronomie. Er und seine Kollegen haben das letzte Jahrzehnt damit verbracht, immer besser zu verstehen, wie Planeten entstehen. Neue Forschungsergebnisse, die Klahr zusammen mit seinem Doktoranden und späteren Postdoktoranden Andreas Schreiber erzielte, werfen ein ganz neues Licht auf die Frage nach der bevorzugten 100-Kilometer-Skala.
Zumindest in groben Zügen ist die Geschichte der Planetenentstehung bereits seit Jahrzehnten bekannt. Nimmt man ein populärwissenschaftliches Astronomiebuch aus den 1970er Jahren zur Hand, kann man dort bereits lesen, wie von der anfänglichen Scheibe aus Gas und Staub, die die junge Sonne umgab, Materie übrigblieb, und wie sich diese Materie zu Planeten verklumpte. Aber die Details dieses Prozesses nachzuvollziehen, hat sich als erstaunlich schwierig erwiesen.
Nicht „klebrig“ genug
Der Staub in der Gasscheibe, die einen neugeborenen Stern umgibt, kann zwar tatsächlich recht einfach zu dem verklumpen, was Astrophysiker als Pebbles bezeichnen, wörtlich „Kieselsteinchen“, nämlich Klumpen von einigen Millimetern bis zu einigen Zentimetern Größe. Aber der Schritt von dort zu kilometergroßen Objekten hat der Planetenentstehungsforschung lange Zeit Probleme bereitet.
Werden Pebbles größer, passieren mehrere Dinge. Zum einen neigen Pebbles ab einer gewissen Größe dazu, bei einer Kollision eher zu zerbrechen als aneinander zu haften. Eine Zeit lang sah es zwar so aus, als könne Wassereis auf der Oberfläche der Pebbles da Abhilfe schaffen und sozusagen als Klebstoff dienen. Doch das funktionierte weniger gut als erhofft, nicht zuletzt, weil Eis bei sehr niedrigen Temperaturen nicht besonders klebrig ist. Dennoch gehen eine Reihe von Forschenden davon aus, dass Eis für den Übergang von Kieselsteinen zu größeren Objekten eine Rolle spielt.
Das Problem der Zeit
Trotzdem haben die konventionellen Szenarien, ob mit oder ohne Eis, ein Zeitskalenproblem. Das Gas der protoplanetaren Scheibe läuft um den jungen Stern mit einer geringeren Geschwindigkeit, als es ein einzelnes festes Objekt tun müsste, das den Stern umkreist. Fachsprachlich ausgedrückt bewegt sich das Gas mit weniger als der Kepler-Geschwindigkeit. Deswegen neigen größere Pebbles dazu, nach innen zu driften und schließlich in den Stern zu fallen.
Bei langsamen Wachstumsraten wären die fraglichen Objekte daher im Inneren ihres Sterns gelandet, bevor sie die erforderliche Größe erreicht hätten. Nur Objekte, die größer als etwa ein Meter sind, können dieser fatalen Drift entgehen – sie werden weitgehend unabhängig von den Stößen des umgebenden Gases. Doch wie können Objekte diese Größe erreichen?