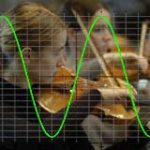Gespür für den Beat: Ob wir ein gutes Rhythmusgefühl haben, hängt auch von unseren Genen ab. Von welchen, hat ein Forschungsteam durch Genomvergleiche bei mehr als 600.000 Menschen herausgefunden. Sie identifizierten dabei 69 Genvarianten, die eng mit dem Taktgefühl verknüpft waren. Dies bestätigt, dass Musikalität und Rhythmusgefühl durch das Zusammenwirken vieler genetischer Komponenten beeinflusst werden, darunter auch solchen, die bei biologischen Rhythmen wie Gehen oder Atmen eine Rolle spielen.
Musik und Rhythmus haben tiefe biologische Wurzeln: Schon Ungeborene im Mutterleib reagieren auf Musik und in unserem Gehirn gibt es sogar ein eigenes Gesangszentrum. Zwar spielen Umwelteinflüsse und Übung für die Musikalität eine wichtige Rolle, Studien legen aber nahe, dass Musikalität und Rhythmusgefühl zumindest in Teilen auf eine genetische Veranlagung zurückgehen. Dafür spricht auch, dass sogar einige Tierarten wie Kakadus und Lemuren ein fast menschenähnliches Rhythmusgefühl zeigen.
Spurensuche im Erbgut von mehr als 600.000 Menschen
Aber welche Gene stecken hinter dem menschlichen Rhythmusgefühl? Um das herauszufinden, haben Maria Niarchou von der Vanderbilt University in Nashville und ihre Kollegen dazu erstmals eine großangelegte genomweite Vergleichsstudie mit mehr als 600.000 Teilnehmenden durchgeführt. Diese wurden gefragt, ob sie den Takt halten und einen Rhythmus nachklatschen können, bei einer kleineren Stichprobe wurde dies zudem in einem Online-Experiment überprüft.
„Die menschliche Fähigkeit, sich synchron zum Takt der Musik zu bewegen, bezeichnet man als Taktsynchronisation. Unsere Validierungs-Experimente ergaben, dass die Selbsteinschätzung der Teilnehmenden mit der objektiv gemessenen Taktsynchronisation übereinstimmten“, erklärt Koautor Nori Jacoby vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main. Anschließend suchten die Forschenden im Erbgut aller Teilnehmenden nach Genvarianten, die eine Korrelation zum Rhythmusgefühl ihrer Träger zeigten.
69 Genvarianten mischen mit
Das Ergebnis: Das eine Gen für den Rhythmus gibt es nicht, dafür aber viele Genvarianten, die zu einem guten Gespür für Takt beitragen. „Varianten an 69 Genorten erreichten dafür eine genomweite Signifikanz“, berichtet das Forschungsteam. „Die Rhythmus-Synchronisation wird demnach von einer hochgradig polygenischen Architektur geprägt.“
Damit ähnelt das Taktgefühl vielen anderen komplexen, von vielen Genvarianten beeinflussten Merkmalen. „Es gibt dabei viele Gene mit geringer Auswirkung – wahrscheinlich sogar mehr, als wir identifizieren konnten“, sagt Jacobys Kollegin Miriam Mosing. „Zusammen erklären sie einen Teil der Unterschiede bei der Rhythmusfähigkeit der Menschen. Doch auch die Umwelt spielt eine entscheidende Rolle.“ Zusammen machen die jetzt identifizierten 69 Genvarianten rund 13 bis 16 Prozent des vererbbaren Taktgefühls aus.
Enger Zusammenhang zum Chronotyp, zur Atmung und dem Gehen
Interessant ist jedoch auch, wo diese Rhythmus-Genvarianten liegen. So zeigen einige dieser Gene einen engen Zusammenhang mit biologischen Rhythmen wie der Atmung und dem Gehen. Assoziationen fanden die Wissenschaftler aber auch mit motorischen Funktionen, der akustischen Wahrnehmung, der Reaktionszeit und dem Chronotyp. „Menschen, die sich eher als Abendtyp bezeichneten, neigten dazu, den vorgegebenen Rhythmen präziser zu folgen – selbst als wir professionelle Musiker ausschlossen“, berichtet das Team.
Viele der Rhythmus-Genvarianten liegen aber auch in oder bei Genen, die an grundlegenden neuronalen Funktionen und der frühen Gehirnentwicklung beteiligt sind. Darunter waren auch einige Gene, die im Kleinhirn aktiv sind. „Das Cerebellum spielt eine besonders wichtige Rolle bei der Kontrolle von koordinierten Bewegungen, bei der Atmung, beim Gleichgewicht, dem Tanz und selbst beim passiven Hören von Musik“, erklären Niarchou und ihre Kollegen. Insofern sei der Zusammenhang zum Rhythmusgefühl naheliegend.
Die Ergebnisse liefern damit neuen Einblicke in die Verknüpfungen zwischen menschlichem Genom und Musikalität. Weitere Studien könnten nun an den jetzt identifizierten Genvarianten anknüpfen und ihre Funktionen noch genauer erkunden. (Nature Human Behaviour, 2022; doi: 10.1038/s41562-022-01359-x)
Quelle: Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik