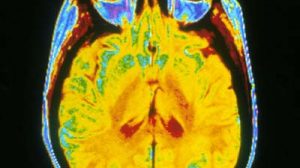Gestörte Schaltzentrale: Tinnituspatienten und Menschen mit chronischen Schmerzen haben die gleichen Anomalien im Gehirn, wie Forscher entdeckt haben. Bei ihnen sind Hirnareale, die als „Türhüter“ für Reize fungieren, sowohl strukturell als auch in ihrer Funktion verändert. Damit wird nicht nur klarer, woher die lästigen Ohrgeräusche kommen. Das neue Wissen um die betroffenen Areale im Gehirn liefert auch Ansätze für effektivere Therapien.
Von Tinnitus sind allein in Deutschland rund drei Millionen Menschen betroffen. Typischerweise hören sie ein störendes Piepen, Summen oder Rauschen, obwohl diese Geräusche objektiv gar nicht zu hören sind. Lange suchte man im Ohr nach den Ursachen dieser quälenden Störgeräusche, doch seit einigen Jahren setzt sich die Erkenntnis durch, dass das Gehirn selbst den Tinnitus erzeugt. Nach gängiger Theorie funktionieren die Filter nicht mehr richtig, die normalerweise unwichtige und störende Sinneseindrücke unterdrücken.
Jetzt haben Josef Rauschecker von der Georgetown University und Kollegen von der Technischen Universität München entdeckt, wo im Gehirn diese defekten Filter sitzen und welche Hirnareale bei Tinnituspatienten verändert sind. Mit Hilfe einer ganzen Batterie von bildgebenden und analytischen Verfahren fanden sie heraus, dass vor allem der Nucleus accumbens und der ventromediale präfrontale Cortex die gestörte Wahrnehmung verursachen.
Gestörte Türhüter“
„Diese Areale fungieren als zentrale Türhüter für unsere Sinneswahrnehmungen“, erklärt Rauschecker. Sie regeln, welche Informationen von den Sinnesorganen in unser Bewusstsein dringen und weiter verarbeitet werden. „Außerdem sind diese Hirnbereiche wichtig, um emotionale Erfahrungen zu bewerten und zu modifizieren. Sie bestimmen so den emotionalen Gehalt unserer Sinneseindrücke.“
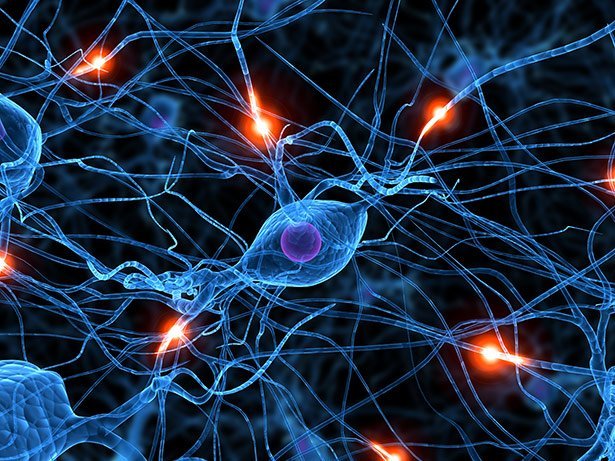
Fallen jedoch diese Türhüter aus oder funktionieren nicht mehr richtig, dann werden auch solche externen oder aber im Gehirn selbst erzeugten Sinnesreize weitergeleitet, die normalerweise unterdrückt würden. Als Folge hören wir Geräusche, die nicht da sind – wir leiden an Tinnitus. Erkennbar wurde dies ganz konkret am Gehirn der betroffenen: Ihre graue Masse war in diesen Arealen verringert und auch die Verknüpfungen zu anderen Hirnregionen funktionierten anders als bei Gesunden.
Überraschende Parallelen zu chronischen Schmerzen
Aber nicht nur das: Die Forscher stießen auch auf überraschende Gemeinsamkeiten von Tinnitus und chronischen Schmerzen: Bei Schmerzpatienten waren die gleichen Hirnareale strukturell und funktionell verändert. „Wen dieses System gestört ist, dann kann das sowohl Tinnitus als auch chronischen Schmerzen auslösen“, so Rauschecker.
Im Grunde ist das einleuchtend. Denn auch bei chronischen Schmerzen tut den Patienten etwas weh, obwohl die Ursache des Schmerzes längst behoben ist. Das Schmerzgedächtnis sorgt dafür, dass im Gehirn noch immer Schmerzsignale erzeugt werden. „Das Gehirn spürt weiterhin die ursprüngliche Verletzung, weil es die Schmerzsignale nicht mehr herunterregeln kann“, erklärt Rauschecker.
Hoffnung auf neue Therapien
Die neuen Erkenntnisse bergen auch Hoffnung auf Abhilfe. Denn wie die Forscher berichten, spielen die Botenstoffe Dopamin und Serotonin eine wichtige Rolle für den zentralen Türhüter im Gehirn. Das aber bedeutet, dass man möglicherweise die Fehlfunktion dieses neuronalen Schaltkreises durch Beeinflussung dieser Neurotransmitter lindern oder sogar beheben könnte. Das könnte Betroffenen endlich einen Weg aus dem Teufelskreis von Störgeräuschen oder Schmerzen bieten.
Noch allerdings ist das Zukunftsmusik, denn dafür muss noch einiges untersucht und geklärt werden, bis solche Behandlungen in Reichweite rücken, wie die Forscher betonen. Aber auch bei der Diagnose könnten die neuen Erkenntnisse helfen: „Das bessere Verständnis könnte genutzt werden, zum standardisiert zu bewerten, wie hoch das Risiko eines Menschen für Tinnitus oder chronische Schmerzen ist“, sagt Markus Ploner von der TU München. „Das wiederum könnte frühere und gezieltere Behandlungen erleichtern.“ (Trends in Cognitive Sciences, 2015; doi: 10.1016/j.tics.2015.08.002)
(TU München, 24.09.2015 – NPO)