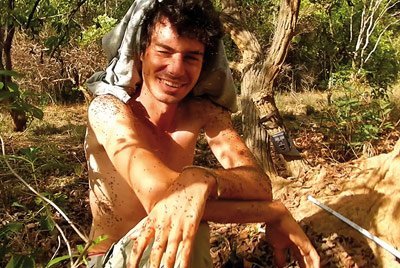Zusammen mit seinem Freund, dem Wiener Studenten Raffael Hickisch, entspann Aebischer die Idee von der Expedition ins Niemandsland, vom Vorstoß ins Innerste Afrikas. Manche würden sagen: die fixe Idee. Nur Fotos eines schwedischen Großwildjägers namens Erik Mararv, der im Chinko-Becken fernab jeder Zivilisation ein gediegenes Jagdcamp unterhält, gaben den zwei Pionieren eine Ahnung, welcher Schatz dort noch verborgen liegt. „Also kontaktierten wir Erik ganz frech und fragten an, ob er an Forschung in seiner Jagdzone interessiert ist“, erinnert sich Aebischer.

Die Website von Erik Mararv verspricht "die exklusivsten Safaris Zentralafrikas" © www.cawasafari.com
Besuch beim Großwildjäger
Dem Großwildjäger machten die zwei im Juni 2011 in Schweden ihre Aufwartung. Erik Mararv, 28, setzte die beiden Studenten über mögliche Risiken und Nebenwirkungen ins Bild, befand sie ansonsten für tropentauglich und lud sie in die Wildnis ein. Hütten, Transport, Verpflegung – alles stand zur Verfügung. Mararv bot, was niemand sonst hatte. Kein anderes Unternehmen, keine NGO unterhält auch nur eine Buschhütte oder ein Plumpsklo im Chinko-Becken. Ein Schuss Verrücktheit ist auch dem Schwedenjäger – Lebensmotto: „Nichts ist unmöglich“ – nicht ganz wesensfremd.
Mararv wuchs in der Z.A.R. auf, jagte schon mit 15 und hatte mit 18 eine Jagdlizenz. Seit sieben Jahren ist der Chinko sein Revier. CAWA heißt sein Unternehmen, Central African Wildlife Adventures. Seine Frau Emelie macht die Buchungen, eine Handvoll anderer verwegener Männer, meist Weiße, die der Geist David Livingstones geweckt hat, kümmert sich um den Rest. Zu Mararv kommen Jäger aus Europa und den USA, die schon fast jede Trophäe über dem Bett hängen haben, denen nur noch das Geweih dieser oder jener seltenen Antilopenart fehlt. Lord Derby-Eland, Bongo, Lelwel-Kuhantilope. Oder auch das Fell von Löwe oder Leopard. „Tiere, die es anderswo in Afrika entweder nicht gibt oder die woanders nicht gejagt werden dürfen“, sagt Aebischer.

Begehrte Trophäe für Großwildjäger, die sonst schon alles haben: Leoparden im Chinko © Chinko Project, Aebischer/Hickisch
Klinkenputzen für die Forschung
Aebischer und Hickisch, beide 26, ließen sich nicht lange bitten. Nur war der Spaß nicht umsonst zu haben. Die zwei schrieben eine Liste, was das alles kosten würde: vier Ferngläser à 217,44 US-Dollar, 37 Kamerafallen zu je 240 Dollar, ein Team aus Trägern, Fährtenlesern, Jagdführern, für 70 Tage machte das allein 14.002 Dollar, dann die Flüge, Transport in den Busch, Medikamente, Notebook, Satellitentelefon, Batterien und und und. Auf 51.836 Dollar und einen Cent kamen sie.
Das Klinkenputzen auf der Suche nach dem großen „Sugar Daddy“, dem freigiebigen Sponsor, verlief frustrierend. Internationale NGOs machen seit langem einen großen Bogen um den Chinko. „Viele staatliche Institutionen, aber auch NGOs fanden das Risiko sehr groß und wollten nicht die Verantwortung für eine solche Expedition übernehmen“, erzählt Aebischer.
Expedition mit minimalsten Mitteln
Alle winkten ab: vom WWF bis zu den Großkatzenschützern von Panthera. Zu gefährlich, zu aufwendig, und mit dem Mini-Etat sowieso nicht zu machen, hieß es. Das Duo ließ sich nicht beirren, legte eigenes Geld auf den Tisch, sammelte bei Freunden, Familie und Firmen, kratzte 50.000 Euro zusammen. Später gelang es, noch 12.000 Euro bei der Basler Stiftung für biologische Forschung loszueisen. Ziel der Expedition war, die im Chinko vorhandenen Großsäugetiere zu erfassen, ihre bevorzugten Habitate zu bestimmen und die Populationsgrößen abzuschätzen.
Als dann in Afrika die zoologischen Neuigkeiten von den Speicherkarten der Kamerafallen nur so herunterplumpsten wie Elefantenköttel, da wollten auch die Großkatzenschützer von Panthera in New York aufspringen, und in Washington schickte sich die „National Geographic Society“ flugs an, ihren Mann für Afrika in Marsch zu setzen. Der musste am Ende aber doch passen, als in der Zentralafrikanischen Republik der jüngste Bürgerkrieg ausbrach.
Kai Althoetmar
Stand: 11.10.2013