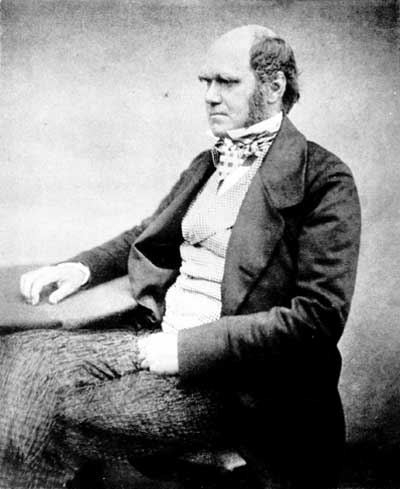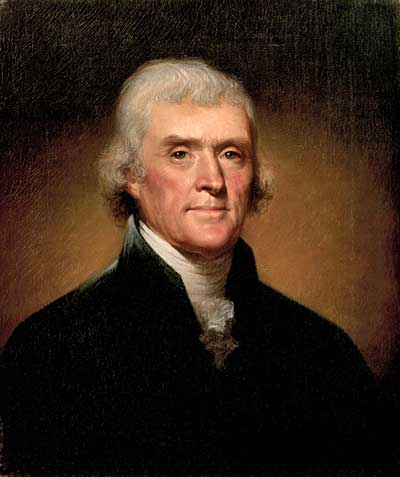Smilodon - Das Kalifornische Staatsfossil © California State Archives / gemeinfrei
Rund 500 Millionen Tierarten sind im Laufe der Erdgeschichte nach Schätzungen von Wissenschaftlern bereits ausgestorben. Neben dem fortwährenden, schleichenden Verschwinden einzelner Spezies gab es immer wieder Perioden in der Erdgeschichte, in denen unzählige Arten nahezu zeitgleich „k.o.“ gingen.
Dramatische Aussterbewelle
So fielen am Ende der letzten Eiszeit unter anderem Großtiere wie Mammuts, Wollnashörner, Säbelzahnkatzen oder Höhlenlöwen einem solchen Massenaussterben zum Opfer. Von einem plötzlichen Zusammenbruch ihrer Populationen betroffen waren damals auch rund 90 Prozent der existierenden Riesenfaultierarten. Megatherium americanum gehörte genauso dazu, wie Mylodon domesticum, Eremotherium laurillardi oder Megalonyx jeffersonii.
„Es war genauso dramatisch wie der Untergang der Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren“, bewertet der Paläontologe und Riesenfaultier-Experte David Steadman von der Universität Florida die Situation vor rund 10.000 Jahren.

Megatherium americanum © LadyofHats / gemeinfrei
Gründe für das Aus
Doch was waren die Gründe für das Aus der Arten, die zuvor zum Teil Millionen von Jahren auf der Erde schadlos überstanden hatten? Darüber streiten Wissenschaftler bereits seit Jahrzehnten heftig. Der Klimawandel und damit eine deutliche Erwärmung nach Ende der Eiszeit waren schuld, sagen die einen. Die Tiere konnten sich demnach nicht schnell genug an die sich wandelnden Umweltbedingungen anpassen und gingen etwa an Nahrungsmangel zugrunde. Andere Forscher gehen davon aus, dass vom Menschen eingeschleppte Infektionskrankheiten unzählige Opfer unter den Großsäugern forderten und so entscheidend zum Massenaussterben beitrugen.
Und dann gibt es noch Wissenschaftler, die einen anderen Zusammenhang zwischen der Ausbreitung unserer Vorfahren und dem Verschwinden der so genannten Megafauna sehen: die Jagd. Die Anhänger dieser so genannten „Overkill-Hypothese“ vermuten, dass Menschen im großen Stil die willkommene Fleischbeute erlegten und dadurch in rasantem Tempo viele Arten ausrotteten.
Faktor Mensch
Dass zumindest für die Riesenfaultiere Amerikas die Bejagungstheorie als wichtigster Auslöschungsgrund in Frage kommen könnte, haben Biologen um Steadman im Jahr 2005 gezeigt. In ihrer Studie datierten sie mithilfe der Radiocarbon-Methode die versteinerten Knochen und den fossilen Kot von ausgestorbenen bodenlebenden Faultieren auf dem amerikanischen Festland und den Inseln Kuba und Hispaniola neu.
Es stellte sich dabei heraus, dass Riesenfaultierarten wie Megalonyx jeffersoni oder Eremotherium laurillardi in Nordamerika bereits vor rund 11.000 Jahren ausstarben, ihre Verwandten in Südamerika ereilte das gleiche Schicksal erst 500 Jahre später. Die Faultiere auf den Westindischen Inseln überlebten dagegen erstaunlicherweise sogar bis vor 4.400 Jahren, so die Wissenschaftler.
Während der Klimawandel in Nordamerika beim Artensterben eine Rolle gespielt haben könnte, war dies auf Kuba und Hispaniola definitiv nicht der Fall. Dort gab es nach Angaben der Forscher vor 4.400 Jahren stabile Temperatur- und Umweltbedingungen. Viel eindeutiger war ein anderes Resultat: In allen untersuchten Regionen verschwanden die Riesenfaultiere jeweils kurz nachdem die Menschen dort ankamen, schreiben die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS).
Weitere Indizien dafür, dass vermutlich Großwildjäger schuld an der Ausrottung der Faultiere waren, lieferte die Analyse des fossilen Dungs. Danach fraßen die Tiere damals bereits Pflanzen, die heute noch existieren. Veränderungen in der Vegetation – und damit Nahrungsmangel – als Auslöschungsfaktor, seien damit vom Tisch, so Steadman und seine Kollegen. Die langsamen Tiere hätten einfach keine Erfahrung mit menschlichen Feinden gehabt und seien damit eine leichte Beute für die prähistorischen Jäger gewesen.

Dreifinger-Faultier © Stefan Laube (Tauchgurke) / gemeinfrei
Heutige Faultiere vor dem Aus?
Zumindest eine Frage bleibt jedoch noch offen: Warum überlebten die heute noch existierenden baumlebenden Faultiere damals die Verfolgung durch den Menschen? Perfekte Tarnung, sagen Forscher. Denn im feucht-warmen Pelz der Tiere haben sich gleich mehrere Arten blaugrüner Algen eingenistet. Sie verleihen dem Fell einen grünlichen Schimmer, der dafür sorgt, dass die Faultiere in den Baumkronen kaum auffallen. Da sie zudem viel schlafen und sich in den Wachphasen nur sehr langsam fortbewegen, war und ist das Risiko entdeckt zu werden ziemlich gering.
Trotzdem sind auch die modernen Faultiere in Gefahr, denn vor allem die fortschreitende Lebensraumzerstörung bedroht ihre Zukunft auf der Erde. Da ihr Fleisch als ziemlich schmackhaft gilt, werden die Faultiere zudem auch heute noch regelmäßig von den Regenwaldbewohnern getötet und landen im Kochtopf.
Dieter Lohmann
Stand: 10.02.2012