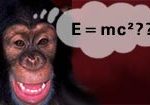Bringen zurückhaltende Eigenschaften bei einem Überschuss an Weibchen einen Vorteil, weil Männchen treuere Weibchen bevorzugen? Wenn das der Fall wäre, dann könnte es sich hierbei möglicherweise um eine Art „strategische Programmierung“ der Töchter durch ihre Mütter handeln. Um diese Hypothese zu überprüfen, will der Verhaltensbiologe in den kommenden Monaten die Nachkommen von Müttern aus verschiedenen sozialen Umwelten in der Voliere mit Weibchenüberschuss testen. Zurückhaltendere Weibchen sollten dann bei der Paarbildung erfolgreicher sein.
„Möglicherweise ist weibliche Promiskuität auch eine genetische Folge von männlicher Promiskuität“, spekuliert Forstmeier. Wenn eine bestimmte genetische Variante zu erhöhter Promiskuität beider Geschlechter führt, dann könnte diese Variante an Häufigkeit allein dadurch zunehmen, dass sie den männlichen Trägern einen Reproduktionsvorteil verschafft, während sie sich in weiblichen Trägern selektionsneutral verhält.
Wäre weibliche Promiskuität lediglich eine solche genetische Begleiterscheinung männlicher Promiskuität, dann müsste sich dies über Vererbungsanalysen nachweisen lassen. „Schwestern und Brüder sollten sich dann ähnlich verhalten“, sagt Forstmeier. Dafür haben die Wissenschaftler aber keinerlei Anhaltspunkte gefunden. Sie gehen deshalb davon aus, dass männliche und weibliche Promiskuität unterschiedliche genetische Ursachen haben.
Forstmeier gehört zur Generation jener Wissenschaftler, die sich auf das beobachtbare Verhalten konzentrieren und unter dem Eindruck der Theorien von John Maynard Smith, William Hamilton und Robert Trivers nach dem Anpassungswert von Verhalten suchen. Diese Verhaltensökologie hat die klassische, von Konrad Lorenz begründete Verhaltensforschung abgelöst, die sich in erster Linie mit der Steuerung von Verhalten befasste, sich aber nur wenig für die evolutionäre Funktion des Verhaltens interessierte. Es wird allerdings noch eine Vielzahl an Vogelgenerationen in Seewiesen brauchen, bis sich die Frage nach dem Wert individueller Einzigartigkeit unter evolutionsbiologischen Gesichtspunkten beantworten lässt.
Stand: 16.03.2007