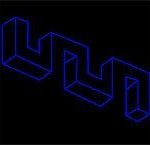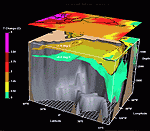Ob es um Partner geht, um Wohnungen oder um Gebrauchtwagen: Wenn wir uns nicht selbst entscheiden können, greift jemand anderes zu. Die 37-Prozent-Regel berücksichtigt dies. Aber folgt daraus, dass wir uns bei realen Entscheidungen an dieser Regel orientieren sollten? Und dass wir irrational sind, wenn wir es nicht tun? Diese Schlussfolgerung wurde tatsächlich von Wissenschaftlern wie den Schweizer Ökonomen Bruno Frey und Reiner Eichenberger propagiert. Die meisten Menschen, argumentierten Frey und Eichenberger, verhielten sich bei ihrer Partnerwahl irrational und würden sich „unterhalb ihrer Möglichkeiten“ liieren.
Peter Todd wollte wissen, ob das stimmt. Leben wir, mathematisch betrachtet, unter unseren Möglichkeiten? Einem der Leitgedanken von bounded rationality folgend, stellte er sich die Frage, ob es für Menschen bei der sequenziellen Wahl wirklich vernünftig ist, nach der besten aller Optionen zu streben, anstatt sich mit einer einfacheren, für den Zweck aber ausreichenden Lösung zu bescheiden. Im Grunde hätte Peter Todd schon damit punkten können, überzeugend vorzurechnen, dass die bestmögliche Lösung in Wahrheit nur diejenige sein kann, die auch den Aufwand einer Suchstrategie mit einberechnet.
Betrachtet man die Sache, wie in der Geschichte des Sekretärsproblems, einmal aus männlicher Sicht, ergibt sich nämlich folgendes Bild: Folgt der Sekretär der 37-Prozent-Regel, muss er nicht nur zuerst eine Testmenge von 37 Kandidatinnen inspizieren, um sich einen Eindruck zu verschaffen; er muss darüber hinaus im Durchschnitt noch einmal 37 Kandidatinnen prüfen, um auf eine zu treffen, die einen höheren Wert als die beste Kandidatin aus der Testmenge besitzt. Und bei dieser Rechnung ist noch nicht einmal berücksichtigt, dass in der Realität die Menge der Kandidatinnen die Summe von 100 bei weitem übersteigt. Wie will man es lebenspraktisch bewältigen, hier nach der mathematisch besten Strategie zu verfahren?
Eine Frage der Risikobereitschaft
Aber Peter Todd hat noch etwas viel Besseres gefunden als diesen Einwand gegen die 37-Prozent-Regel: ein Verfahren, das selbst dann überlegen ist, wenn man den Aufwand der Suche ganz außer Acht lässt. Man muss sich lediglich die Zahlen vor Augen halten. Wer sich auf die 37er-Regel verlässt, geht – so sagt es das mathematische Modell – zwar in 67 Prozent aller Fälle mit einer Braut nach Hause, deren Mitgift im oberen Zehntel liegt. Aber er hat ein Risiko von acht Prozent, auf einer Braut sitzen zu bleiben, deren Mitgift sich lediglich im unteren Viertel der Skala befindet. Anders als für den Berater, der seinen Kopf verliert, wenn er nicht die Beste gewinnt, spielt diese Verteilung von Chancen und Risiken unter gewöhnlichen Umständen keine große Rolle.
Auf einmal ist es gar nicht mehr ausgemacht, welches Verfahren das Beste ist. Die Methode, welche die meisten Bräute im obersten Zehntel der Mitgift- Rangliste liefert, arbeitet zum Beispiel mit einer Testmenge von zwölf Prozent der Kandidatinnen. In 77 Prozent aller Fälle wählt man mit diesem Verfahren eine Braut aus den oberen 10 Prozent aus. Wer sich mit einer Braut im oberen Viertel zufrieden gibt, ist schon mit der 8-Prozent-Regel gut bedient, die Gewinnchancen stehen hier bei 90 Prozent. Und wer nicht auf Gewinne aus ist, braucht nur zwei Prozent zu sichten; auf diese Weise kann er sicher sein, mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit eine Braut zu bekommen, die zumindest über dem untersten Viertel liegt.
Für den Mann oder die Frau auf Partnersuche kommt es bei der Wahl der richtigen Strategie – nicht anders als etwa bei der Entscheidung zwischen verschiedenen Formen der Geldanlage – also vor allem auf die individuelle Risikobereitschaft an. Zum anderen muss man in Betracht ziehen, welche Art von Gewinnen in der Realität des evolutionären Prozesses, in dem wir leben, sich überhaupt auszahlen. Die Situation des Beraters, der sterben muss, wenn er die falsche Braut erwischt, gibt diese Realität vermutlich nur schlecht wieder. Auf der anderen Seite aber ist es keineswegs ausgemacht, welche der anderen möglichen Strategien zum evolutionären Erfolg führen. Kommt es darauf an, mit großer Wahrscheinlichkeit einen betuchten Partner zu finden? Oder mehr darauf, nicht an einen Ladenhüter von Mann zu geraten? Diese Fragen stehen auf der Agenda für zukünftige Forschung.
Zusammen mit Kollegen wie dem Evolutionspsychologen Geoffrey Miller, auch er ein ehemaliger Max-Planck-Wissenschaftler, hat Todd das Modell bereits in vielen Einzelschritten in anderer Hinsicht weiter ausgebaut. Es wurde an Situationen angepasst, in denen die Anzahl der möglichen Partner unbekannt ist und wo man anstelle eines bestimmten Prozentsatzes nur eine bestimmte Anzahl testen kann.
Außerdem wurde ein weiteres Merkmal eingebaut, das den kleinen, aber feinen Unterschied zwischen einer Partnerwahl und einer sequenziellen Wahl wie der Suche nach einem Gebrauchtwagen oder einer Wohnung nicht unterschlägt: Zumindest in der westlichen Welt hat die Braut oder der Bräutigam nämlich das Recht, eine Offerte abzulehnen – und das tun sie ihrerseits mit Blick auf das Attraktivitätsniveau oder den finanziellen Hintergrund des Bewerbers.
Stand: 12.05.2006