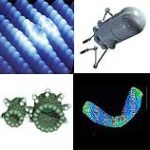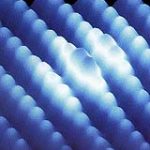Den Anstoß zur Entwicklung der drahtlosen Sensornetze gab das Pentagon. 1998 erhielt Kristofer Pister, Professor am Institut für Elektrotechnik und Informatik der Universität Berkeley, den Auftrag, winzige Computer in der Größe von Sandkörnchen zu entwickeln. Hinter dem Projekt stand die DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), die Forschungsabteilung des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums.
Mit Hilfe der Kleinst-Rechner wollte das Pentagon einen uralten Traum aller Militärs wahr machen und unbeobachtet feindliche Truppenbewegungen überwachen. Mit Tausenden dieser unsichtbaren „Spione“, auf Schlachtfeldern verstreut, erhoffte man sich, den Gegner kontrollieren zu können.
Intelligente Staubkörnchen
Die Smart Dust Motes, (intelligente Staubkörnchen) sollten maximal einen Kubikmillimeter groß sein, dabei aber Sensoren und einen Mikro-Prozessor enthalten, untereinander Daten drahtlos austauschen und sich innerhalb von Netzwerken selbst organisieren können. Außerdem mussten sie über eine eigene Energieversorgung verfügen und gleichzeitig energiesparend arbeiten können. „Wir hatten keine Ahnung, wofür man dies alles würde verwenden können, und in unseren wildesten Träumen hätten wir nicht gedacht, da zu landen, wo wir jetzt sind,“ so Pister rückblickend.
Als das „Smart Dust“-Projekt im Jahr 2001 beendet wurde, hatten Pister und seine Kollegen zwar keinen intelligenten Staub entwickelt. Doch sie waren der Vision des US-Militärs ziemlich nahe gekommen. Eine ganze Serie verschiedener Modelle von Sensorknoten war entstanden, einige nur knapp fünf Kubikmillimeter groß, nicht größer als ein Reiskorn. Ausgestattet waren „Golem Dust“ oder „Flash Dust“ mit Bewegungs- oder Lichtsensoren und mit Solar- oder Batterieantrieb. Die Kommunikation erfolgte per Funk oder auf optischem Wege.
Praxistest im Feld
Den ersten Testlauf absolvierten die Sensorknoten auf einer Militärbasis in Kalifornien. Sechs Mini-Computer wurden aus einem Flugzeug über einer Straße abgeworfen, wo sie sich nach der Landung selbständig zu einem Netzwerk organisierten. Sie maßen das Magnetfeld, das sich veränderte, sobald ein Auto vorbeifuhr. Gemeinsam berechneten die Sensorknoten Geschwindigkeit und Richtung der Autos und sendeten die Daten anschließend an einen Laptop im benachbarten Militärcamp.
Nach dem „Smart Dust“-Projekt wurden zahlreiche weitere Anwendungen konzipiert und auf Praxistauglichkeit getestet. So entwickelte die Vanderbilt University ein Netz aus 60 akustischen Sensoren, die, verteilt über ein Testgebiet von einem Hektar, Schützen auf einen Meter genau lokalisierten. Durch Druckwellen konnte die Schussrichtung ermittelt werden, und selbst, ob der Schütze stehend oder kniend geschossen hatte, erkannten die Sensoren und funkten es weiter.
Neues Forschungsgebiet
Aus der anfänglich „fixen Idee“ ist mittlerweile ein völlig neues Forschungsfeld zwischen Elektrotechnik und Informatik entstanden, das nun auch zivile Anwendungen ins Auge fasst. Auf der einen Seite wird die Hardware weiter entwickelt. Man versucht, die Sensorknoten immer weiter zu miniaturisieren. Die Bauweise – Sensor, Prozessor, Funkeinheit, Energiequelle – bleibt dabei stets die gleiche.
Auf der anderen Seite arbeitet man an neuen Software-Ansätzen. Mit der Networked Embedded Software Technology NEST (netzwerkgebundene Software) werden zum Beispiel spezielle Softwareprotokolle oder „Arbeitsanweisungen“ entwickelt, die die Kommunikation und Arbeitsabläufe in großen, vernetzten Schwärmen intelligenter Kleinstcomputer koordinieren.
Die Vision des Erfinders
Kristofer Pister, der Erfinder des Smart Dust, sieht die Zukunft drahtloser Sensornetze so: „Im Jahr 2010 wird es überall Mikrosensoren geben, die ständig Daten über ihre Umgebung sammeln und Energie aus Sonnenlicht, Vibrationen oder Temperaturunterschieden beziehen, damit sie permanent Funksignale empfangen und senden können. Diese Sensorknoten werden nahezu unzerstörbare Ein-Chip-Computer sein, jeder ausgestattet mit einer Sensor- und Kommunikationseinheit und autarker Stromversorgung. Kompakt gebaut und ohne natürliche Zerfallsprozesse, werden sie sogar den Menschen überleben.“
Stand: 31.03.2006