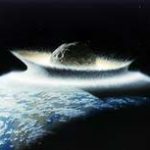Man benötigt nicht mehr als Hammer und Spaltkeil, einen Eimer, ein Küchenmesser und ein schattiges Plätzchen, um als Paläontologe in Stöffel fündig zu werden. Mit Spaltkeil und Hammer schlägt man ein geeignetes Stück Schiefer ab, trägt es mit dem Eimer aus der Grube und spaltet es mit dem Messer in dünne Lagen. Spätestens nach zehn Minuten findet man ein erstes Fossil. Ein schattiges Plätzchen ist von besonderer Qualität. Denn die Sonne knallt den Ausgräbern auf die Köpfe und der schwarze Basalt potenziert den Hitzeffekt des Steinbruchkessels.
Zwar liegt das Jahresmittel von neun Grad Celsius heute fast acht Grad niedriger als vor 26 Millionen Jahren, doch die 30 Grad Celsius eines holozänen Sommers reichen den zehn Studenten völlig aus. Sie studieren Geologie, Mineralogie oder Geographie und kommen aus der ganzen Republik: Kiel, Tübingen, Bochum, Heidelberg, Aachen. Einer ist aus Wales, eine sogar aus Minnesota, USA.
Die Grube ist etwa drei Meter breit, sechs Meter lang und zwei Meter tief. Beim Ausheben muß Johnny, der Baggerfahrer ran, denn aus bergbaurechtlichen Gründen liegt im ganzen Steinbruch noch eine meterdicke Basaltschicht auf dem Ölschiefer. Um dessen Oberfläche nicht zu verletzten, müssen die Studenten mit Spitzhacke und Schaufel die Schichtgrenze bis zum seidenmatt glänzenden Ölschiefer herunter kratzen. Die einzelnen Lagen unterscheiden sich in der Regel gut voneinander, was wichtig für die zeitliche Einordnung der gefundenen Fossilien ist.
Am meisten Erfolg versprechen große Schieferplatten, denn je größer die Schichtflächen desto größer die Chance ein gut erhaltenes Fossil zu finden. Die eigentliche Suche ist wie Austern öffnen. Man sucht sich eine Schwachstelle, dringt mit dem Messer tief zwischen die Lagen, und trennt sie auseinander. Blick auf die Platte. Nichts. Nächste Schicht. Wieder nichts. So geht es weiter, doch etwa alle fünf Minuten findet man etwas, einen Fisch, Blätter, Samen, manchmal eine Spinne, Kaulquappen, Samen.
Alle noch so kleinen Funde werden gemeldet: „Kauli, zwei Zentimeter“, „Fisch, vollständig“, „Insekt, pyritisiert“, tönt es durcheinander, und für den Schreiber ist gar nicht leicht, alles aufs Papier zu bekommen. Manchmal ruft einer „Krokodil!“, doch nur die Studenten fallen darauf rein. Die Grabungsleiter kennen den Witz schon seit Jahren.
Besonders gut erhaltene und wissenschaftlich interessante Funde kommen in einen Wassereimer, damit sie nicht austrocknen. Der Rest wandert auf die Halde. Ist eine Schicht abgetragen, ist die nächste, darunterliegende dran. Alle paar Lagen erscheint harter Tuff, Zeugnis reger Vulkantätigkeit des tertiären Westerwaldes. Der muß natürlich auch weg gehackt werden. Gentlemanlike halten sich (üblicherweise) die Herren der Ausgrabung zur Verfügung, denn drei Kubikmeter Tuff sind eine echte Herausforderung für lehrbuchgewohnte Knochen.
Nach achtstündiger Arbeit ist um fünf Uhr Schluss und die Truppe macht sich auf den Weg in das zehn Minuten entfernt gelegene Lager. Das besteht aus zwei Containern in einer kleinen Lichtung, und, wichtig, aus einer Feuerstelle. Abends kommt Lagerfeuerromantik auf, alle sitzen ums Feuer herum, trinken Bier und witzeln über die Verrückten, über die im Dorf jeder lacht: Sie kommen jeden Sommer, um im Steinbruch im Dreck zu wühlen. Und das macht ihnen dann auch noch Spaß.
Stand: 14.10.2005