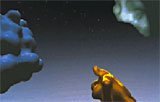Das fragile Gebilde einer lebenden Zelle hält energiereiche Strahlung wie etwa Elektronen nur sehr begrenzt aus. Wird die Bestrahlungszeit und damit die Dosis zu hoch, „verkohlt“ die Zelle und ist für eine weitere Untersuchung verloren. Die Erfahrung hat gezeigt, dass 2.000 bis 5.000 Elektronen auf einer Fläche von einem Quadrat-Nanometer die obere Grenze bilden – lächerlich wenig, wenn man diese Zahl auch noch auf Hunderte von Bildern verteilen muss. Gleichzeitig benötigt aber die Tomographie viele Einzelaufnahmen. Je mehr verschiedene Projektionen eines Objekts der Computer kombiniert, desto höher ist die erreichbare Auflösung, desto „schärfer“ werden die 3-D-Bilder. Viele Aufnahmen bedeuten jedoch auch eine hohe Strahlenbelastung.
Die Idee, Elektronentomographie für wissenschaftliche Zwecke zu betreiben, ist schon 35 Jahre alt. Im Jahr 1968 veröffentlichten drei Forschergruppen erste prinzipielle Studien dazu, die jedoch wegen der damals verwendeten Technik in ihrer Anwendbarkeit äußerst limitiert waren. Erst im Laufe der neunziger Jahre hatten sich die Geräte- und vor allem die Computertechnik und Informatik so weit entwickelt, dass man allmählich an einen Einsatz für Auflösungen im Nanometerbereich auch bei intakten Zellen denken konnte.
„Wahrscheinlich führen beim heutigen Stand des Wissens neue Methoden und Techniken häufiger zu Erkenntnisfortschritten als neue Hypothesen“, sagt Wolfgang Baumeister, der seit 1988 als Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie die treibende Kraft des Tomographieprojekts ist. „Das steht in einem sonderbaren Kontrast zu der verhältnismäßig geringen Wertschätzung, die der methodisch orientierten Forschung zuteil wird.“
Es gab sogar Diskussionen darüber, ob die Entwicklung eines bildgebenden Verfahrens überhaupt Aufgabe der Max- Planck-Gesellschaft sei – oder ob nicht vielmehr die Industrie solche Tomographen entwickeln und herstellen müsse. Der Biophysiker gibt hierauf eine klare Antwort: „Wenn die Industrie nicht willens ist, dieses Risiko einzugehen und uns diejenigen Instrumente zur Verfügung zu stellen, die wir für unsere wissenschaftlichen Fragestellungen brauchen, dann müssen wir sie eben selbst produzieren.“ Man tat dies allerdings in enger Kooperation mit einschlägigen Firmen.
Stand: 18.03.2004