Das Weltraumteleskop steht nicht still: Es rast mit acht Kilometern pro Sekunde um die Erde. Für eine Umkreisung benötigt es daher nur 1,5 Stunden. Aus dieser rasenden Geschwindigkeit heraus ein fernes, winziges Objekt im All stabil ins Visier zu nehmen, scheint da geradezu unmöglich. Doch Hubble nutzt für seine Peilung ein ganz simples Grundprinzip der Physik.
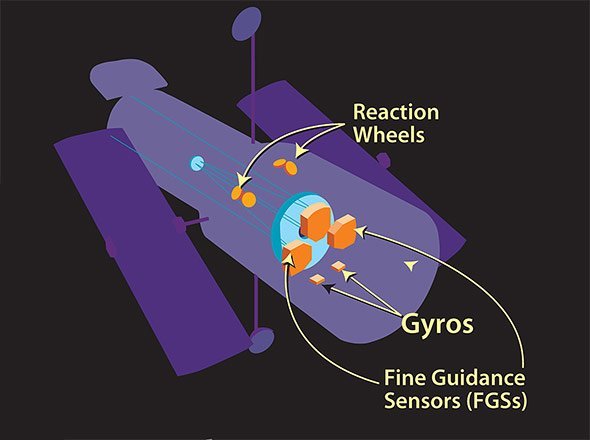
Trägheitsräder statt Düsenantrieb
Das etwa busgroße Weltraumteleskop bewegt sich komplett ohne Antriebssystem im Orbit. Es besitzt weder Schubdüsen noch andere per Rückstoßprinzip funktionierende Manövrierhilfen. Denn ihre Ausgasungen würden dem Teleskop das Sichtfeld vernebeln. Dennoch ist es alles andere als unbeweglich – ganz im Gegenteil: Hubble kann seine Zielobjekte mit einer Genauigkeit von 0,01 Bogensekunde anpeilen und mit einer Abweichung von nur 0,07 Bogensekunden über 24 Stunden verfolgen. Das entspricht dem Zielvermögen eines Lasers, mit dem man eine Münze in rund 250 Kilometern Entfernung treffen könnte.
Um sich auf ein Zielobjekt auszurichten, nutzt Hubble das dritte Newtonsche Gesetz: actio gleich reactio. Jede Krafteinwirkung erzeugt eine gleich starke, aber entgegen gerichtete Kraft. Konkret heißt dies: Das Teleskop dreht sich, indem es die Geschwindigkeit von vier Paaren sogenannter Trägheitsräder ändert. Diese sechs knapp 60 Zentimeter großen Räder können mit bis zu 3.000 Umdrehungen pro Minute rotieren. Werden sie durch Elektromagnete abgebremst oder beschleunigt, übt dies eine Kraft auf das Teleskop aus, die dieses in die jeweils entgegengesetzte Richtung dreht. Sechs Gyroskope überprüfen dabei ständig die Lage im Raum.
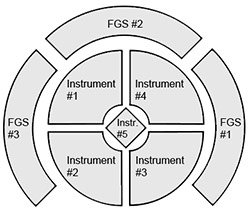
Der Leitstern gibt die Richtung vor
Das Ganze wäre allerdings nutzlos, wenn es nicht Systeme gäbe, die dem Teleskop sagen, wohin es sich drehen soll und die diese Bewegung auch präzise kontrollieren. An dieser Aufgabe sind gleich mehrere Sensoren beteiligt. Zunächst wird aus einer Sternendatenbank ein Leitstern ermittelt – ein helles Himmelsobjekt, das dem Zielobjekt möglichst nahe liegt. Nach diesem suchen dann drei spezielle Kameras, die sogenannten Fine Guiding Sensors (FGS).
Diese sitzen ringförmig um die restlichen Instrumente und fangen das Bild des Leitsterns auf. Ob dieser genau im Zentrum des Sehfelds von Hubble sitzt, registrieren sie mit Hilfe der Interferometrie: Ihre Signale werden von einem Computer so miteinander verrechnet, dass eine Wanderung des Objekts aus dem Zentrum eine Phasenabweichung im Signal auslöst. Tritt dies ein, gibt der Computer den Befehl, das Teleskop nachzujustieren.
Wer darf wann ran?
Die Entscheidung, welches Objekt Hubble ins Visier nimmt, trifft ein Auswahlkomitee am Space Telescope Science Institute (STScI) in Baltimore. Pro Jahr gehen dort etwa 1.000 Anträge von Wissenschaftlern aus aller Welt ein, von denen rund 200 ausgewählt werden – die Auswahl läuft dabei nicht viel anders als bei anderen Großteleskopen auch.

Kriterien sind neben der Bedeutung der Fragestellung für die Astronomie und einer gut durchdachten Herangehensweise auch die Frage, warum es für das Forschungsprojekt ausgerechnet Hubble sein muss. 15 Prozent der Beobachtungszeit ist dabei europäischen Forschern und Forschergruppen zugeteilt – im Austausch gegen die 15 Prozent Beteiligung der Europäischen Raumfahrtagentur ESA beim Bau und Betrieb des Teleskops.
Zusätzlich aber sind zehn Prozent von Hubbles Beobachtungszeit für besondere Aufgaben reserviert. Damit soll die Möglichkeit geschaffen werden, das Teleskop auch ganz kurzfristig und unbürokratisch auf Zielobjekte auszurichten – beispielsweise wenn ein kurzlebiges Ereignis wie ein Gammastrahlenausbruch oder eine Supernova registriert wird. Aber auch Projekte, die länger dauern, aber verschiedenen Bereichen der Astronomie zugutekommen, wie die berühmten Hubble Deep Fields, werden in dieser Reservezeit umgesetzt.
Nadja Podbregar











