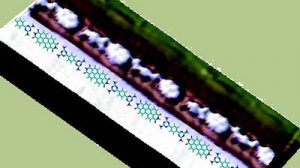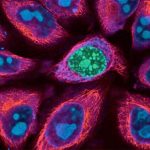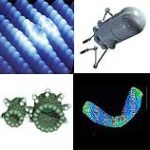Gelangen Nanopartikel in Gewässer, hat das nicht nur für Mikroben und Algen darin fatale Folgen. Auch Kleinkrebse werden durch Titandioxid-Nanoteilchen geschädigt – und dies so nachhaltig, dass noch die Nachkommen der exponierten Krebse an den Folgen leiden. Das zeigte sich 2012 in einem Versuch von Forschern der Universität Koblenz-Landau. Das Überraschende daran: In den üblichen Toxizitätstests an der Elterngeneration waren die negativen Folgen nicht nachweisbar. Sie zeigten sich erst bei deren Nachkommen.

Für ihre Studie hatten die Forscher Wasserflöhe in Wasser mit 0,02 bis 2 Milligramm pro Liter Titandioxid-Nanopartikeln gehalten. Diese Konzentrationen liegen um mehr als das 50-Fache unter dem, was laut früheren Studien für diese Tiere schädlich ist. Die Auswirkungen dieser Exposition prüften die Wissenschaftler nach einem von der OECD genormten Standardprotokoll, bei dem unter anderem die Schwimmfähigkeit und Aktivität der Wasserflöhe eingestuft wird. Wie die Forscher berichten, machten sich in diesen Tests auch nach längerer Zeit keine negativen Folgen bei den Krebsen bemerkbar.
Nachkommen weniger überlebensfähig
Die von diesen Wasserflöhen produzierten Nachkommen unterzogen die Forscher dann ebenfalls Tests, indem sie diese für jeweils kurze Zeit in Becken mit erhöhten Titandioxid-Konzentrationen setzten. „Die Jungtiere von Wasserflöhen aus mit Nanopartikeln versetztem Wasser reagierten zwei bis fünf Mal sensibler als die Nachkommen unbelasteter Krebse“, berichten Mirco Bundschuh und seine Kollegen. Ihre Schwimmfähigkeit sei schon bei sehr geringen Titandioxid-Konzentrationen beeinträchtigt gewesen. Im Freiland kann dies die Überlebensfähigkeit der Wasserflöhe stark verringern, da sie beispielsweise vor Fressfeinden nicht mehr schnell genug wegschwimmen können.
„Die Studie untermauert, dass Nanomaterialien aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften überraschende Wirkungen hervorrufen können“, sagt Studienleiter Ralf Schulz. In klassischen Chemikalientests – die oft mit Wasserflöhen durchgeführt werden – wird nur die Reaktion der jeweils direkt den Stoffen ausgesetzten Tiere überprüft. Die nächste Generation untersucht man üblicherweise jedoch in diesen Standardtests nicht. „Daher reichen klassische Untersuchungen und Risikobewertungen nicht aus“, sagt der Forscher. Die Zulassungsbehörden müssten sich zügig für eine Weiterentwicklung und Einführung angepasster Tests einsetzen, um auch langfristige Risiken zuverlässiger bewerten zu können. Denn Nanopartikel gelangten schließlich dauerhaft in die Umwelt.
Nadja Podbregar
Stand: 08.03.2013