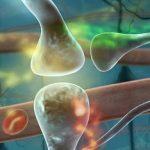Auf die Gehirnwellen kommt es an: Wie gut jemand lernt, hängt auch von den Oszillationen der Hirnströme ab – und diese lassen sich trainieren, wie nun ein Experiment belegt. Dafür lernten Probanden zunächst, mittels Neurofeedback die sogenannten Alpha-Wellen ihres Gehirns zu fördern. Dann absolvierten sie eine Lernaufgabe für ihren Tastsinn – und lernten dabei deutlich besser und schneller als Probanden ohne dieses Training.
Unser Gehirn muss ständig gewaltige Mengen an Eindrücken und Reizen verarbeiten. Komplexe Filtersysteme sorgen jedoch dafür, dass die Verarbeitungsressourcen auf die wichtigen Informationen beschränkt bleiben – sonst droht Überlastung. Schon länger ist bekannt, dass die sogenannten Alpha-Oszillationen für diese Unterdrückung irrelevanter Informationen wichtig sind. Diese im Rhythmus von acht bis 13 Hertz schwingenden Hirnströme wirken sozusagen als „Torwächter“ in der Informationsflut.
Das Spannende daran: Studien haben gezeigt, dass ein erhöhter Anteil dieser Alpha-Wellen die Aufmerksamkeit fördert und auch das Abschneiden bei kognitiven Aufgaben. Unklar blieb aber bisher, ob sich diese Oszillationen der Hirnströme auch direkt auf die Lernfähigkeit auswirken. Das haben Marion Brickwedde und ihre Kollegen von der Ruhr-Universität Bochum nun in einem Experiment untersucht.
Alpha-Wellen im Neurofeedback
Im Versuch lernten die 76 Probanden zunächst, den Anteil ihrer Alpha-Wellen durch Neurofeedback zu beeinflussen. Bei den Farbmuster auf einem Bildschirm gaben ihnen dabei in Echtzeit Rückmeldung über die Hirnströme im somatosensorischen Cortex – dem Hirnteil, der Sinneneindrücke verarbeitet. „So konnten die Teilnehmer lernen, durch welche Gedanken oder Gefühle sie eine Verstärkung oder Verringerung von Alpha-Oszillationen hervorrufen können“, erklärt Brickwedde.
Das Entscheidende aber: Die Hälfte der Teilnehmer sollte über das Neurofeedback ihre Alpha-Wellen fördern, die andere Hälfte sollte sie möglichst unterdrücken. Mit Erfolg: Hirnstrommessungen nach zwei solcher Trainings an aufeinanderfolgenden Tagen zeigten, dass beide Gruppen den Anteil ihrer Alpha-Oszillationen entsprechend den Vorgaben verändert hatten.
Tastsinn verbessert sich schneller
Nun folgte die Lernaufgabe: Die Forscher berührten den Zeigefinger der Probanden wiederholt mit zwei dünnen, unterschiedlich nah beieinanderstehenden Nadeln. Typischerweise führt dies zu einem Lerneffekt des Tastsinns: Nach einem solchen Tasttraining können die Probanden feinere Abstände wahrnehmen als zuvor. Würde sich dieser Lerneffekt auch bei den Probanden einstellen – und in welcher Form?
Das Ergebnis: Die Teilnehmer, die im Neurofeedback ihre Alpha-Wellen gezielt gefördert hatten, schnitten im Lernversuch deutlich besser ab als eine untrainierte Kontrollgruppe. Ihr Tastsinn verbesserte sich messbar, wie die Forscher berichten. Anders war es dagegen bei den Probanden, die ihre Alpha-Oszillationen unterdrücken sollten: „Die Alpha-Down-Gruppe zeigte keinerlei Veränderung ihrer Tastfähigkeit“, so Brickwedde und ihr Team.
Alpha-Wellen-Training als Lernstrategie?
Nach Ansicht der Wissenschaftler belegen ihre Ergebnisse zwei Dinge: Für einen guten Lernerfolg ist offenbar tatsächlich ein hoher Anteil von Alpha-Wellen im Gehirn wichtig. „Immerhin rund 59 Prozent der individuellen Lernunterschiede in dieser Wahrnehmungsaufgabe ließen sich durch die Stärke der Alpha-Oszillationen vor Lernbeginn erklären“, sagen die Forscher. Sie vermuten, dass die Alpha-Wellen durch ihre Filtertätigkeit vermehrt neuronale Ressourcen für das Lernen freimachen.
Der zweite Aspekt: Wie ausgeprägt die Alpha-Oszillationen in unserem Gehirn sind, lässt sich beeinflussen. „Alpha-Neurofeedbacktraining könnte also ein Mittel darstellen, Lernerfolg in alltäglichen, aber auch in rehabilitativen oder klinischen Kontexten zu verstärken“, folgert Seniorautor Hubert Dinse von der Ruhr-Universität Bochum. So könnten beispielsweise Schlaganfallpatienten durch Neurofeedback schneller lernen, verlorene Fähigkeiten wieder zurückzugewinnen. (Nature Communications, 2019; doi: 10.1038/s41467-018-08012-0)
Quelle: Ruhr-Universität Bochum