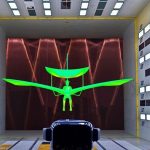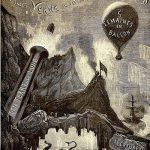Moderne Luftschiffe ähneln zwar äußerlich durchaus noch ihren Vorbildern aus der großen Ära der Zeppeline. Unter der Hülle jedoch hat sich einiges geändert – aus gutem Grund. Denn die klassischen Luftschiffe waren wegen ihrer Wasserstoffladung zu leicht brennbar, schwer am Boden zu halten, windanfällig und benötigten viel Personal für Betrieb und vor allem Start und Landung. Die modernen Nachfahren der „Hindenburg“ und ihrer Zeitgenossen nutzen modernste Technik, um diese Nachteile zu überwinden.
Das Traggas
Ein Ansatzpunkt ist das Traggas: Weil Wasserstoff als zu gefährlich gilt, verwenden heutige Luftschiffe meist Helium. Dieses ist zwar nicht ganz so auftriebsstark wie Wasserstoff, dafür ist dieses Edelgas nicht so leicht entzündlich. Das Problem jedoch: Während Wasserstoff leicht durch Elektrolyse aus Wasser erzeugt werden kann, sind die Heliumvorkommen begrenzt und das Helium entsprechend teuer. Zurzeit kostet ein Kubikmeter Helium mehr als sieben Euro.
Das macht die Befüllung eines Luftschiffs nicht nur extrem kostspielig, auch die frühere Praxis, bei der Landung einfach Gas abzulassen, kommt aus ökonomischen Gründen nicht in Frage. Moderne Luftschiffe lösen dieses Problem, indem sie das Helium bei der Landung und beim Entladen der Fracht so stark komprimieren und kühlen, dass es schwerer wird als Luft. Dadurch dient es als Ballast.
Doch auch Wasserstoff ist nicht komplett vom Tisch. Nach Ansicht einiger Luftschiff-Experten ist es heute im Gegensatz zur Ära der Hindenburg durchaus möglich, Hüllen und Kammern aus Verbundmaterialien zu konstruieren, die die Feuergefahr minimieren. „Wenn die Entwicklung weiter fortgeschritten ist und sich die Menschen wieder an Luftschiffe gewöhnt haben, werden sie wahrscheinlich wieder zu Wasserstoff wechseln“, prognostiziert Barry Prentice von Buoyant Aircraft Systems International (BASI). Die russische Firma RosAeroSystems soll schon einen chemischen Zusatzstoff entwickelt haben, der Wasserstoff weniger entzündlich macht.