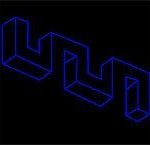Multitasking für die Forschung
Es geht aber auch anders: Cao und Händel haben für ihre Studie nun die Hirnströme und das Sehen bei gehenden und stehenden Probanden verglichen. Alle Teilnehmer mussten dabei eine per Video-Headset vor ihre Augen projizierte Aufgabe lösen: Sie sollten sagen, ab wann ein langsam eingeblendetes Gitternetz aus schwarzen und weißen Linien für sie sichtbar war. Das Testmuster wurde dabei in unterschiedlichen Regionen des Gesichtsfelds gezeigt.
Die Wahrnehmung und Hirnaktivität zeichneten die Forscherinnen mit einer Elektronenhaube auf und registrierten die Augenbewegungen mit einem Eyetracker. Dieser sollte dabei helfen, die elektrischen Signale der Augenmuskeln aus dem EEG herauszufiltern.

Barbara Händel (l.) und Probandin beim Vorbereiten des Experiments. © Robert Emmerich / Universität Würzburg
Besserer Blick für die Peripherie
Das Ergebnis: In Ruhe erkannten die Teilnehmer wie erwartet die Kontrastmuster im Zentrum ihres Gesichtsfelds am besten. In der Peripherie dagegen nahm ihre visuelle Wahrnehmung deutlich ab. Anders dagegen bei den gehenden Probanden: Sie nahmen die Veränderungen in der Peripherie signifikant besser wahr, wie die Tests ergaben. „Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Gehen zu einer verstärkten Verarbeitung der peripheren Seheindrücke führt“, sagen die Forscherinnen.
Anders ausgedrückt: Wenn ein Mensch herumläuft, verarbeitet er visuelle Eindrücke offenbar anders als in Ruhe: Das periphere Gesichtsfeld wird dann stärker ausgelesen. Gestützt wird diese Beobachtung von den EEG-Daten des Experiments. Sie zeigten, dass eine bestimmte Sorte von Hirnströmen, die Alphawellen, bei gehenden Probanden deutlich schwächer wurden.
Reiz-Filter gehemmt
Nach Ansicht der Forscherinnen könnte dies erklären, warum wir in Bewegung mehr Eindrücke vom Rand unseres Sehfelds wahrnehmen: „Die Messungen von Alphawellen bei neurokognitiven Studien deuten darauf hin, dass sie dazu dienen, irrelevante Informationen auszublenden“, erklären Cao und Händel. Wenn wir uns in Ruhe auf etwas konzentrieren, gehören dazu auch die Signale von der Peripherie des Sehfelds.
Wenn wir jedoch gehen oder laufen, sind diese Rand-Informationen wichtig: „Es ist vor allem die periphere visuelle Information, die uns Aufschluss über die Richtung und Geschwindigkeit unserer Bewegung gibt und damit für unsere Navigation eine wichtige Rolle spielt“, erklärt Händel. Wie genau jedoch Laufen, Alphawellen und Wahrnehmung der Peripherie miteinander verknüpft sind, ist vorerst noch unklar. Offen bleibt bislang auch die Frage, ob das Gehen möglicherweise noch andere Aspekte unserer Wahrnehmung oder Kognition verändert.
Verbessert Gehen das Denken und die Kreativität?
Noch bleiben einige Fragen zur veränderten Wahrnehmung bei Bewegung weiter. Tritt er nur bei visuellem Input auf oder möglicherweise auch in anderen sensorischen Bereichen? Spielt er, neben der Navigation, vielleicht auch bei anderen kognitiven Fähigkeiten wie Gedächtnisleistung und Kreativität eine Rolle? Unwahrscheinlich ist dies nicht. Denn von Ratten ist bekannt, dass die Tiere besser lernen, wenn sie in Bewegung sind. Auch von Menschen gebe es erste Hinweise auf eine solche Wirkung, so Händel.
Und sogar die Kreativität könnte gesteigert sein, wenn wir in Bewegung sind: „Die Peripatetiker, eine philosophische Schule um Aristoteles, diskutierten zum Beispiel meist im Gehen, wovon sich auch ihr Name ableitet“, sagt Händel. Offenbar gibt es zwischen den Bewegungen des Körpers, der geistigen Leistungsfähigkeit und auch der Kreativität noch einige Verknüpfungen, die erst in Ansätzen erforscht sind. (PLOS Biology, 2019; doi: 10.1371/journal.pbio.3000511)
Quelle: Julius-Maximilians-Universität Würzburg
21. November 2019
- Nadja Podbregar