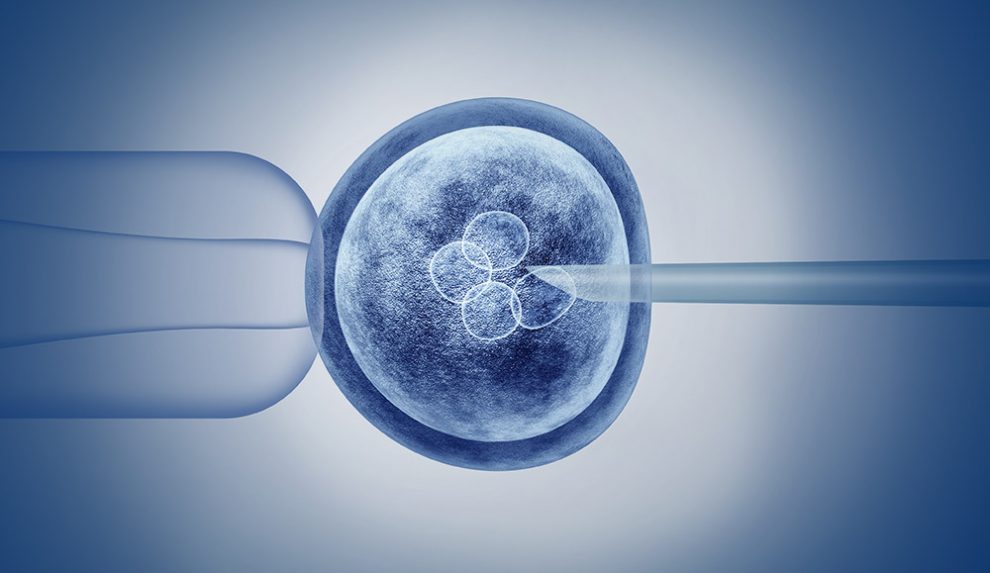Umstrittene Diagnostik: Bisher sind Gentests bei Embryonen nur für wenige Erbkrankheiten möglich und zulässig. Doch nun haben Forscher ein Verfahren entwickelt, durch das auch das genetische Risiko für Krebs, Diabetes oder Darmentzündungen mittels Präimplantationsdiagnostik bestimmt werden kann. Die Treffsicherheit entspreche dabei fast der eines Gentests bei schon geborenen Kindern, so das Team in „Nature Medicine“. Das wirft erhebliche ethische Fragen auf.
Die Präimplantationsdiagnostik (PID) wurde ursprünglich entwickelt, um bei der künstlichen Befruchtung die Embryos zu identifizieren, die wegen schwerer Chromosomenanomalien ohnehin nicht lebensfähig wären. Wenn solche Embryos vor dem Einpflanzen in die mütterliche Gebärmutter erkannt und nicht verwendet werden, verringert dies das Risiko für einen Misserfolg der Kinderwunsch-Behandlung.
Ethisch umstritten
Das Problem jedoch: Weil diese Gentests auch Gendefekte bei ansonsten lebensfähigen Embryos identifizieren können, ermöglicht dies eine ethisch umstrittene Selektion: Embryonen mit Trisomie-21 oder krankmachenden Mutationen können theoretisch auch als „minderwertig “ und „nicht lebenswert“ deklariert und verworfen werden. Im Extremfall könnte die Präimplantationsdiagnostik sogar eine Auswahl genoptimierter Wunschkinder möglich machen.
Unter anderem deshalb ist die PID in Deutschland nur in Ausnahmefällen erlaubt: Zugelassen ist sie nur dann, wenn Eltern die genetische Anlage für eine schwere Erbkrankheit tragen und daher befürchten müssen, dass auch ihr Kind diese vererbt bekommt. Außerdem darf dieser Gentest nur an einem staatlich zugelassenen PID-Testzentrum durchgeführt werden und muss vorher durch eine Ethikkommission geprüft werden. In einigen anderen Ländern sind die Regelungen allerdings deutlich weniger streng – auch, weil die Technik bisher ohnehin nur bei wenigen, von einem dominanten Gen bestimmten Krankheiten funktioniert.
Gentest auch für Krebs, Diabetes und Co
Doch genau das könnte sich nun ändern. Denn ein Team um Akash Kumar vom Biotech-Unternehmen MyOme in Kalifornien hat eine Methode entwickelt, mit der erstmals auch das genetisch bedingte Risiko für gängige Krankheiten am frühen Embryo bestimmt werden kann. Diese Krankheiten, darunter mehrere Krebsarten, Diabetes oder die chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen Colitis ulcerosa und Morbus Crohn, gehen meist auf mehrere Risikogene zurück und werden auch durch Umweltfaktoren beeinflusst. Das erschwert Gentests und macht die Ergebnisse nur bedingt aussagekräftig.
Um eine Präimplantationsdiagnostik für so komplexe Krankheitsbilder überhaupt möglich zu machen, haben Kumar und sein Team eine Methodenkombination eingesetzt. Dafür stellten sie zunächst für jede der zwölf untersuchten Krankheiten die bekannten Risikogenvarianten zusammen und ermittelten auf Basis dieser Daten einen polygenischen Risikoindex. Dieser gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung für Träger der jeweiligen Risikogen-Kombinationen steigt.
Kombination von Eltern- und Embryogenom
Für den eigentlichen Gentest entnahmen die Forschenden 110 durch In-vitro-Fertilisation erzeugten Embryos von zehn Paaren jeweils eine Zelle und unterzogen sie einer Gensequenzierung. Parallel dazu analysierten sie auch das Erbgut der Eltern auf Risikogene hin und ermittelten durch Erbgutvergleiche, welche Sequenzen an die Embryos weitervererbt worden waren. Dies ermöglicht es, die bei der DNA-Analyse von nur einer Zelle auftretenden Ungenauigkeiten und Fehler weitgehend auszugleichen.
„Für jeden Embryo ermittelten wir daraufhin das krankheitsspezifische Risiko auf Basis polygenischer Modelle“, erklären Kumar und sein Team. Um die Treffsicherheit zu bewerten, verglichen sie diese Ergebnisse mit Gentests bei zehn schon geborenen Kindern, bei denen deutlich mehr Genmaterial zur Verfügung steht.
Bis auf 99 Prozent genau
Das Ergebnis: „Unser Ansatz ermöglichte die Vorhersage sowohl von seltenen wie häufigen Genvarianten im Erbgut der Embryos“, berichten Kumar und seine Kollegen. Die Treffsicherheit der Risikoeinstufung lag für Embryos drei Tage nach der Befruchtung bei 97 bis 99 Prozent verglichen mit den Gentests bei Kindern. Bei fünf Tage alten Embryos erreichte die PID-Methode sogar eine Genauigkeit von 99 bis 99,4 Prozent.
Durch die Gentests konnten die Forschenden unter anderem Embryos identifizieren, die das Brustkrebs-Gen BRCA1 trugen. „Wir haben bei der Mutter eine zuvor schon identifizierte pathogene BRCA1-Variante bestätigt und konnten feststellen, dass von den 20 Embryos 13 diese Genvariante trugen“, berichtet das Forschungsteam. Anhand des Risikoindex und weiterer Gene ermittelten sie, dass dadurch das Brustkrebsrisiko unter den Geschwister-Embryos um das 15-fache variierte – von 0,35 bei Nicht-Trägern bis zu 5,35 bei Trägern des Brustkrebsgens.
„Wir haben damit demonstriert, dass eine Rekonstruktion des gesamten Genoms bei Embryonen möglich ist“, schreiben Kumar und seine Kollegen. „Sie ermöglicht eine ähnlich akkurate Berechnung des polygenischen Risikowerts wie Gentests bei schon geborenen Kindern.“
Keine verlässliche Aussage über das tatsächliche Krankheitsauftreten
Allerdings räumen sie auch mehrere Einschränkungen ein. So funktioniert ihre PID-Methode nur bei vererbten Risikogenen, nicht bei neu auftretenden Mutationen. Zudem sei noch strittig, wie groß die klinisch relevante Aussagekraft der polygenischen Risikowerte sei. „Auch wenn solche Risikoindices inzwischen durch größere Datenmengen gestützt werden, bleiben sie doch hochgradig experimentell“, geben auch Norbert Gleicher vom Center for Human Reproduction in New York und seine Kollegen einem begleitenden Kommentar zu bedenken.
Der Grund: Jede dieser Krankheiten wird von vielen Genen beeinflusst und selbst alle Risikogene zusammen erreichen nie eine 100-prozentige Wahrscheinlichkeit eines Krankheitsausbruchs. Stattdessen bestimmen auch weitere, noch unbekannte Genvarianten und nichtgenetische Faktoren das Auftreten von Diabetes, Krebs oder Autoimmunkrankheiten. Wenn nun Embryonen allein aufgrund einer ungünstigen genetischen Veranlagung aussortiert werden, steht dies sowohl medizinisch wie ethisch auf sehr wackligen Füßen.
Eng damit verknüpft ist zudem das grundsätzliche Problem einer genetisch motivierten Selektion: Wenn eine Präimplantationsdiagnostik auch für gängige Krankheiten oder sogar weitere Merkmale möglich wird, könnte dies beispielsweise dazu führen, dass wohlhabende Eltern die PID nutzen, um ihren Nachwuchs auf günstige Merkmale und Krankheitsfreiheit hin zu selektieren. Das könnte eine auch genetisch basierte Zweiklassengesellschaft entstehen lassen. (Nature Medicine, 2022; doi: 10.1038/s41591-022-01735-0)