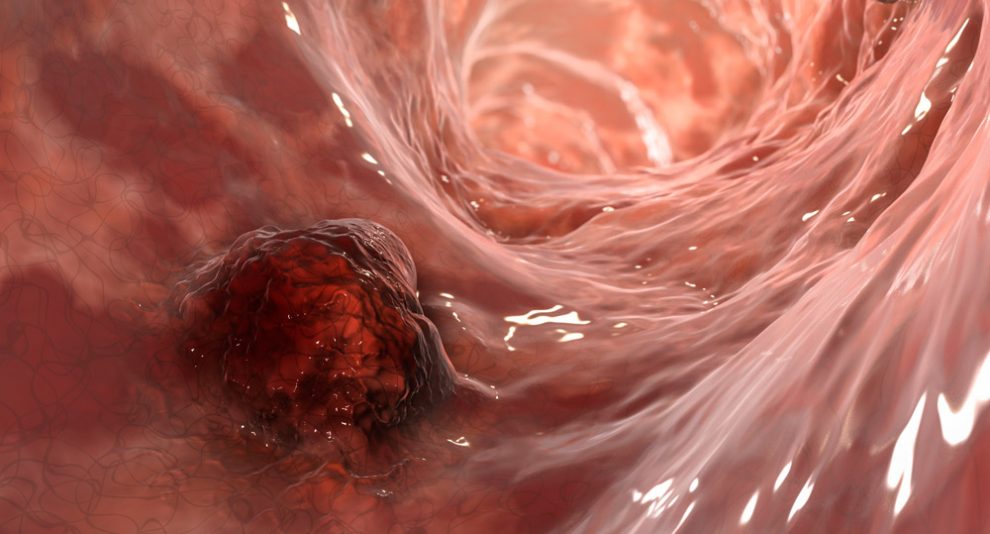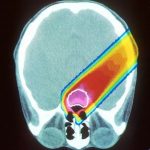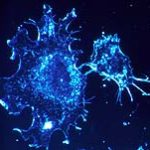Rätselhafte Diskrepanz: Männer scheinen anfälliger für Krebs als Frauen, denn fast alle Tumorarten kommen bei ihnen häufiger vor. Dies bestätigt nun eine US-Langzeitstudie mit mehr als 300.000 Teilnehmenden – und liefert erste Hinweise auf die Ursachen. Demnach kann die oft ungesundere Lebensweise von Männern ihr erhöhtes Krebsrisiko nur zum Teil erklären. Stattdessen geht ein Großteil der geschlechtsspezifischen Unterschiede offenbar auf fundamentale biologische Faktoren zurück.
Jedes Jahr erkranken weltweit fast 20 Millionen Menschen an Krebs, Tumorleiden sind nach Herz-Kreislauferkrankungen die zweithäufigste Todesursache. Trotzdem sind die Ursachen der Entartung von Zellen bisher erst in Teilen geklärt. Klar scheint, dass sowohl genetische Faktoren und Mutationen, als auch Umwelteinflüsse, Viren und die Lebensweise eine Rolle spielen können. Strittig ist aber beispielsweise, warum bei vielen Krebsarten Männer deutlich häufiger betroffen sind als Frauen.
Bis zu 10,8-mal mehr Tumorfälle bei Männern
Wie groß die geschlechtsspezifischen Unterschiede tatsächlich sind und warum, haben Sarah Jackson vom National Cancer Institute in den USA und ihre Kollegen untersucht. Dafür werteten sie Daten von mehr als 170.000 Männern und gut 122.000 Frauen zwischen 50 und 71 Jahren aus, die an einer nationalen Langzeitstudie teilgenommen hatten. Das Team verglich das Auftreten von 21 bei beiden Geschlechtern vorkommenden Krebsarten, aber auch Lebensumstände und Risikofaktoren.
Das Ergebnis: Bei 19 der 21 Tumorarten erkrankten signifikant mehr Männer als Frauen, nur bei Schilddrüsenkrebs und Gallenblase waren mehr Frauen als Männer betroffen. Bei allen anderen Tumorleiden lag das Risiko für Männer je nach Krebsart zwischen 1,3- und 10,8-mal höher als bei ihren weiblichen Altersgenossinnen. Am größten waren die Geschlechtsunterschiede beim Speiseröhrenkrebs, gefolgt von Krehlkopfkrebs und Krebs des Mageneingangs mit jeweils 3,5mal mehr männlichen Fällen.
Riskanterer Lebensstil erklärt nur wenig
Aber warum? Um das zu klären, untersuchten die Forschenden, welche Rolle Unterschiede in der Lebensweise und dem Verhalten spielen. Dafür verglichen sie gezielt Männer-Frauengruppen mit gleichen Risikofaktoren in Bezug auf Rauchen, Ernährung, Gesundheitszustand, potenziell schädlichen Umwelteinflüssen wie Schadstoffen am Arbeitsplatz und weitere Parameter.
Für viele Krebsarten zeigte sich dabei tatsächlich ein Zusammenhang: 50 Prozent des erhöhten Lungenkrebsrisikos lässt sich demnach durch den höheren Anteil von Rauchern bei Männern erklären. Auch bei Tumoren der Speiseröhre, der Leber, des Darms oder der Haut spielt die weniger gesundheitsbewusste Lebensweise der Männer – vor allem bei der Ernährung und dem Alkohol – eine Rolle. Aber selbst diese Faktoren konnten bei keiner Krebsart mehr als Hälfte der Geschlechterunterschiede erklären – die Spanne reichte von elf bis 50 Prozent.
Es muss an der grundlegenden Biologie liegen
Das bedeutet: Lebensweise und Verhalten allein können noch nicht erklären, warum Männer häufiger Krebs bekommen als Frauen – es muss mehr dahinterstecken. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass es bei der Krebshäufigkeit Unterschiede gibt, die nicht allein durch Umweltfaktoren erklärbar sind“, sagt Jackson. „Demnach muss es intrinsische biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen geben, die die Anfälligkeit beeinflussen.“
Zu den möglichen biologischen Faktoren gehören die Wirkungen der Geschlechtshormone und anderer körpereigener Botenstoffe, aber auch geschlechtsspezifische Unterschiede im Immunsystem oder den Genen. Welche Faktoren dies aber genau sind, ist noch unklar. „Diese Geschlechterunterschiede bei Krebs und anderen Krankheiten zu untersuchen und anzugehen, ist eine anhaltende Herausforderung“, kommentieren die nicht an der Studie beteiligten Krebsforscher Graham Colditz und Jingqin Luo von der Washington University.
Sie fordern zudem, die geschlechtsspezifischen Risiken stärker als bisher auch bei Prävention. Früherkennung und Therapie zu berücksichtigen. „Geschlecht als biologische Variable sollte ins gesamte Kontinuum der Krebsmedizin strategisch integriert werden“, so die Wissenschaftler. (Cancer, 2022; doi: 10.1002/cncr.34390)
Quelle: Wiley